Die neusten Entwicklungen
40 Prozent der Infizierten leiden an Long Covid, aber auch Nicht-Infizierte klagen über Symptome. Ein amerikanischer Forscher sieht «starke Evidenz, dass ein Markt in Wuhan Ausgangsort der Corona-Pandemie war». Auch Geimpfte können bei einer Corona-Infektion ansteckend sein. Diese und weitere Forschungsergebnisse zu Sars-CoV-2 und Covid-19.

llustration: Christian Kleeb
Im Frühjahr 2020 wussten wir noch nichts vom Coronavirus und konnten nicht ahnen, wie stark es unser aller Leben beeinflussen würde. Seither ist die Welt eine andere geworden. Die Flut von wissenschaftlichen Studien, die sich mit Sars-CoV-2 und Covid-19 befassen, ist kaum noch zu überschauen. Damit Sie den Überblick behalten, berichten wir in diesem Blog über eine Auswahl von Publikationen.
Die neusten Ergebnisse finden Sie jeweils am Anfang des Artikels. Ältere Beiträge haben wir in einem Verzeichnis aufgelistet – so finden Sie schneller, was Sie suchen.
6. Januar: Auch milde Covid-Verläufe hinterlassen Spuren an den Organen
ni. · Ein Forscherteam des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf hat nachgewiesen, dass milde bis mittelschwere Covid-Verläufe die Organfunktionen von Herz, Lunge und Nieren beeinträchtigen können. Die Effekte sind allerdings grösstenteils minim, wie die Wissenschafter in der Fachzeitschrift «European Heart Journal» schreiben.
Für die «Hamburg City Health Study» haben die Wissenschafter 443 Covid-Patienten umfassend medizinisch untersucht – und das Monate nach durchgemachter Sars-CoV-2-Infektion. Die Probanden waren alle zwischen 45 und 74 Jahre alt und hatten ihre Covid-Erkrankung mit leichten bis mittelschweren Symptomen überstanden. Die grosse Mehrheit von ihnen (93 Prozent) konnte ambulant behandelt werden; niemand benötigte intensivmedizinische Behandlung.
Zur Batterie der Untersuchungen gehörten neben Befragungen zum Gesundheitszustand und der Lebensqualität auch Laboruntersuchungen sowie eine Magnetresonanztomografie (MRT) des Herzens und des Gehirns. All diese Informationen verglichen die Forscher mit den Untersuchungsergebnissen von Personen ohne Covid, die aber bezüglich Alter, Geschlecht und Bildungsstand ähnlich waren (Normalbevölkerung).
Im Vergleich zur Normalbevölkerung fanden sich bei den Covid-Probanden leichte Anzeichen von Organschädigungen. So zeigten sich etwa im Lungenfunktionstest ein um drei Prozent reduziertes Lungenvolumen sowie ein leicht erhöhter Atemwegswiderstand. Die Herzuntersuchungen enthüllten eine Reduktion der Pumpkraft um ein bis zwei Prozent sowie eine Erhöhung eines Proteins im Blut, das auf eine Belastung des Herzmuskels hindeutet. Im Herz-MRT fand sich dagegen keine Auffälligkeit.
Als wichtigstes Studienresultat bezeichnen die Forscher eine weitere Beobachtung: Mit einer Ultraschalluntersuchung der Beine konnten sie bei ihren Covid-Probanden zwei- bis dreimal häufiger die Zeichen einer zurückliegenden Beinvenenthrombose nachweisen, als das zu erwarten gewesen wäre. Das deckt sich mit früheren Erkenntnissen, dass die Infektion mit Sars-CoV-2 zu einer Gerinnungsstörung führen kann. Die Forscher empfehlen deshalb Ärzten, bei ihren Covid-Patienten beim geringsten Verdacht aktiv nach einer Venenthrombose zu suchen.
Die Studie wartet auch mit beruhigenden Ergebnissen auf. So konnten die Forscher bei ihren Probanden keine Hinweise auf einen negativen Einfluss der Corona-Infektion auf die Struktur und Leistungsfähigkeit des Gehirns finden. Auch bei der erfragten Lebensqualität liess sich über die ganze Gruppe kein statistisch signifikanter Unterschied zur Kontrollgruppe finden. Fokussierten die Wissenschafter allerdings auf Probanden mit etwas stärkeren Covid-Symptomen, dann stellten sie leicht höhere Werte bezüglich Depression und Ängstlichkeit fest.
Die «Hamburg City Health Study» ist laut Medienmitteilung die weltweit grösste lokale Gesundheitsstudie. Geplant ist, 45 000 Hamburgerinnen und Hamburger zwischen 45 und 74 Jahren über einen langen Zeitraum hinweg zu untersuchen, um Risikofaktoren für häufige Erkrankungen zu identifizieren. Damit sollen individualisierte Behandlungsmöglichkeiten und eine gezielte Prävention entwickelt werden. Bisher sind rund 16 000 Hamburgerinnen und Hamburger im Rahmen der Studie untersucht worden.
20. Dezember: Long Covid bei 40 Prozent der Infizierten, aber Nicht-Infizierte klagen ebenfalls über Symptome
(dpa) Rund 40 Prozent der mit dem Coronavirus infizierten Menschen haben nach einer Studie der Mainzer Universitätsmedizin mehr als ein halbes Jahr Long-Covid-artige Symptome. Dies treffe nicht nur Menschen mit schweren Krankheitsverläufen, berichtete der Sprecher der Studienleitung der Gutenberg Covid-19 Studie, Philipp Wild, sondern auch solche aus der viel grösseren Zahl Infizierter mit milderen oder sogar asymptomatischen Verläufen, auch wenn diese in der akuten Erkrankungsphase nicht medizinisch behandelt werden mussten. 35 Prozent war die Infektion gar nicht bewusst. Wer länger als sechs Monate nach einer Corona-Infektion noch Symptome hat, leidet nach der Definition der Mainzer Wissenschaftler an Long Covid.
Jeder Dritte berichte, nach einer Infektion mit Sars-CoV-2 nicht wieder so leistungsfähig zu sein wie vorher, sagte Wild. Andere der zahlreichen Symptome «ohne klares klinisches Muster» seien etwa Abgeschlagenheit, Geruchs- und Geschmacksstörungen, Gedächtnisstörungen, Atmennot/Kurzatmigkeit, Gelenkschmerzen sowie Schlafstörungen. Frauen sind häufiger betroffen als Männer, das Alter spielte hingegen keine Rolle. Die Zahl der Long-Covid-Symptome nahm mit der Zeit ab.
Allerdings berichteten auch rund 40 Prozent der gar nicht-infizierten Menschen von einigen ähnlichen Symptomen während der Pandemie, wie Abgeschlagenheit, Schlafstörungen und Stimmungsschwankungen, die mindestens sechs Monate anhielten, sagte Wild. «Es ist aber falsch zu sagen, das Krankheitsbild Long Covid gibt es nicht», betonte der Wissenschaftliche Vorstand der Universitätsmedizin. Diese Ergebnisse zeigten vielmehr, wie wenig spezifisch das Krankheitsbild sei und wie gross der Forschungsbedarf. Der Vorstandsvorsitzende der Unimedizin, Norbert Pfeiffer, sagte: «Das ist möglicherweise auch Ausdruck der Situation der Belastung.»
Zwölf Einrichtungen der Universitätsmedizin forschen jetzt interdisziplinär über Long Covid – von Herz-Kreislauf über die Psyche bis zu den Zähnen. Ziele sind klinische und noch nicht klinische Veränderungen der Organe, die zu Beschwerden führen können, sowie die richtige Versorgung und Behandlung der Betroffenen.
Dafür sollen 600 Menschen mit nachgewiesener Infektion und allen Schweregraden der Erkrankung untersucht werden. Das rheinland-pfälzische Wissenschaftsministerium fördert diesen Teil der Studie mit rund 400 000 Euro. Die Long-Covid-Untersuchung hängt mit der Gutenberg Covid-19 Studie zusammen, die mit mehr als drei Millionen Euro vom Land und der EU unterstützt wird und schon verschiedene Ergebnisse erbracht hat.
Die Covid-19-Studie basiert auf den Daten von 10 250 Menschen aus Mainz und dem Kreis Mainz-Bingen. Insgesamt waren das bis Juli 2021 rund 500 mit dem Coronavirus infizierte Menschen. Viele der 10 250 Menschen geben bereits seit 2007 – lange vor der Pandemie – regelmässig Daten für eine umfassende Gesundheitsstudie ab. Die Datengrundlage beruhe auf einer repräsentativen Bevölkerungsstichprobe und bilde das gesamte Spektrum der von Sars-CoV-2-Infizierten ab, darunter auch die Menschen, die von ihrer Infektion gar nichts wussten, wie Wild sagte.
Inhaltsverzeichnis
- 15. Dezember: Spieltheoretische Experimente zeigen ein verändertes Verhalten von Jugendlichen
- 6. Dezember: FFP2-Masken schützen laut Forschern deutlich besser vor einer Corona-Infektion als OP-Masken
- 18. November: US-Forscher sieht «starke Evidenz, dass ein Markt in Wuhan Ausgangsort der Corona-Pandemie war»
- 2. November: Geimpft, aber trotzdem ansteckend – warum das ein Grund mehr für die Schutzimpfung ist
- 28. Oktober: Das Antidepressivum Fluvoxamin reduziert bei Covid-19 das Hospitalisationsrisiko
- 27. Oktober: Tumorpatienten entwickeln schlechteren Impfschutz – sie sollten unbedingt eine Auffrischung erhalten
- 14. Oktober: Ein BMI über 35 verdoppelt bei Covid-19 das Risiko für einen potenziell fatalen Krankheitsverlauf
- 22. September: Nach den RNA-Impfstoffen kommen nun auch die DNA-Vakzine
- 20. September: Pfizer/Biontech präsentiert erste positive Impfergebnisse bei Kindern unter 12 Jahren
- 16. September: Experten halten kurzfristigen Einfluss der Impfung auf den weiblichen Zyklus für möglich
- 10. September: Corona-Impfung schützt Schwangere und Kind
- 3. September: Genesene haben einen etwas besseren Immunschutz als Geimpfte – aber Impfen ist trotzdem sinnvoll
- 28. August: Doppelt so hohes Risiko für eine Krankenhauseinweisung bei Infektionen mit Delta
- 26. August: Ungenaue Antigen-Schnelltests – jeder dritte Infizierte wird übersehen
- 19. August: Forscher entdecken Schlüssel für eine Super-Immunität
- 17. August: Bei längerem Impfintervall generiert die Pfizer/Biontech-Vakzine eine bessere Antikörperantwort
- 4. August: Kinder mit Covid-19 im Durchschnitt nach sechs Tagen gesund
- 3. August: Genetische Risiken für schwere Covid-19-Verläufe
- 29. Juli: Beeinflusst Covid-19 die Denkfähigkeit nachhaltig?
- 22. Juli: Impfungen mit Pfizer und AstraZeneca sind auch gegen Delta-Variante hochwirksam
- 28. Juni: Wie stark beeinflussen die Jahreszeiten die Ausbreitung des Coronavirus?
- 10. Juni: AstraZeneca-Impfstoff mit leicht erhöhtem Risiko von Blutungsstörungen
- 2. Juni: Begünstigt die Corona-Impfung bei jungen Männern eine Herzmuskelentzündung?
- 25. Mai: Spürhunde erkennen Virus mit einer Genauigkeit von bis zu 94 Prozent
- 21. Mai: Leicht erhöhtes Risiko für Babys kurz vor der Geburt
- 18. Mai: Forscher schätzen, welche Antikörperkonzentrationen mit Schutz vor Sars-CoV-2-Infektion oder schwerer Erkrankung korrelieren
- 7. Mai: Ein Biomarker erkennt schwere Covid-19-Verläufe
- 3. Mai: Wissenschafter identifizieren einen Antikörper, der gegen alle bisher bekannten Mutationen von Sars-CoV-2 effektiv ist
- 1. April: Pfizer/Biontech-Impfstoff soll auch bei 12- bis 15-Jährigen gut wirksam sein
- 25. März: Die Corona-Impfung ist vor einer Operation besonders sinnvoll
- 23. März: Britische Forscher identifizieren erste rekombinante Sars-CoV-2
- 16. März: Höheres Sterberisiko bei einer Infektion mit der britischen Variante von Sars-CoV-2
- 9. März: Mehr Coronavirus-Infektionen bei stärkerem Pollenflug
- 3. März: Viele Covid-19-Patienten entwickeln ein Post-Covid-Syndrom
- 26. Februar: Auch in den USA tauchen neue Varianten von Sars-CoV-2 auf
- 24. Februar: Bereits nach einer Dosis Impfstoff sinkt das Risiko einer Hospitalisierung wegen Sars-CoV-2 erheblich
- 21. Februar: Die Pfizer/Biontech-Vakzine soll Ansteckungen mit Sars-CoV-2 zu fast 90 Prozent verhindern
- 19. Februar: Forscher vermuten, dass das Ausmass der Corona-Pandemie in afrikanischen Ländern deutlich unterschätzt wird.
- 12. Februar: Wer sich trotz einer ersten Impfung mit Corona infiziert, produziert offenbar weniger Viren – und könnte deshalb weniger ansteckend sein
- 11. Februar: Aerosol-«Superspreader» – das Alter und das Gewicht sind ausschlaggebend
- 10. Februar: Das Thromboserisiko bleibt bei Covid-19 zwei Monate lang erhöht
- 5. Februar: Bei Personen, die schon eine Sars-CoV-2-Infektion durchgemacht haben, könnte eine Impfdosis reichen
- 2. Februar: Der AstraZeneca-Impfstoff ist im Tierversuch auch als Nasenspray wirksam
- 27. Januar: Die Verbreitungsgebiete von Fledermäusen «überbrücken» die Strecke zwischen dem Fundort des nächsten Verwandten von Sars-CoV-2 und Wuhan
- 21. Januar: Modellrechnung zeigt: Eine gezielte Teststrategie könnte die Quarantäne in einigen Fällen unnötig machen
- 11. Januar: Versammlungsverbote und Schulschliessungen reduzieren die Mobilität besonders effizient
- 8. Januar: Eine wichtige Veränderung der stärker ansteckenden Sars-CoV-2-Varianten mindert die Wirkung der Impfung von Pfizer/Biontech nicht
- 7. Januar: Personen mit der neuen Virusvariante haben vermutlich eine höhere Virenlast
- 31. Dezember: Warum Bluthochdruck das Risiko für einen schweren Verlauf von Covid-19 erhöht
- 30. Dezember: Coronavirus kann bei Kindern zu starker Entzündungsreaktion führen
- 30. Dezember: Grossbritannien und Argentinien lassen Corona-Impfstoff von AstraZeneca zu
- 26. Dezember: Wie die Stärken und Schwächen verschiedener Corona-Tests nutzbringend eingesetzt werden könnten
- 24. Dezember: Spezielle Immunzellen schützen Ungeborene vor Ansteckung
- 18. Dezember: Dreimal so hohes Sterberisiko durch Covid-19: Bisher grösste Studie zeigt wichtige Unterschiede zu Influenza
- 17. Dezember: Erstmals ein mit Sars-CoV-2 infiziertes Wildtier gefunden
- 15. Dezember: Eine neue Virusvariante breitet sich in England aus
- 14. Dezember: Die Maskenpflicht könnte in Deutschland die Zahl der Neuinfektionen deutlich reduziert haben
- 10. Dezember: Nach AstraZeneca/Oxford publizieren auch Biontech und Pfizer die Ergebnisse ihrer Impfstoffstudie
- 9. Dezember: Baumwollmasken sind Papier überlegen – jedenfalls nach 20-maligem Waschen
- 8. Dezember: Erste wissenschaftliche Publikation zur Wirksamkeit eines Impfstoffs
- 2. Dezember: Wie das Coronavirus ins Gehirn gelangt
- 1. Dezember: Forscher arbeiten an kombinierter Masern-Corona-Impfung
- 24. November: Künstliche Intelligenz «sieht» Covid-19 auf Röntgenbildern
- 24. November: Sars-CoV-2 passt sich in Nerzen an
- 20. November: WHO spricht sich gegen Remdesivir-Behandlung aus
- 16. November: Moderna-Impfstoff soll hohe Wirksamkeit haben
- 16. November: Studie zur Wirkung von Echinaforce gegen Corona relativiert
- 16. November: Johnson & Johnson startet weitere Spätstudie mit Corona-Impfstoff
- 14. November: Ein Inhalationsspray bessert Covid-19-Symptome
- 11. November: Die FDA erteilt Notfallgenehmigung für eine Antikörper-Therapie
- 11. November: Die Massnahmen gegen Covid-19 schützen nur vorübergehend vor anderen respiratorischen Erkrankungen
- 10. November: Kreuzreaktive Antikörper erkennen Sars-CoV-2 und sind häufiger bei Kindern
- 6. November: Sechsmal mehr Kinder infiziert, jede zweite Infektion asymptomatisch
- 5. November: Die Letalität von Covid-19 ist weltweit unterschiedlich, in der Schweiz liegt sie bei 0,75 Prozent
- 4. November: Wer dreckige Luft einatmet, stirbt eher an Covid-19
- 2. November: Der Lockdown hat die Zunahme von Geschlechtskrankheiten nicht gebremst
- 29. Oktober: Eine neue Sars-CoV-2-Variante dominiert Europa
- 28. Oktober: Corona greift auch das Gehirn an
- 27. Oktober: Wie lange verbleiben Antikörper gegen Sars-CoV-2 im Blut?
- 23. Oktober: Körpereigene Hilfe für Sars-CoV-2
- 15. Oktober: Erste Pandemiewelle – in welchem Land gab es wie viele Tote?
- 12. Oktober: Welche Rolle die Übertragung über Aerosole in Büros und Klassenzimmern spielt
- 9. Oktober: Masken senken die Infektionsrate um bis zu 30 Prozent
- 28. September: Fehlgeleitete Antikörper und genetische Defekte als Risikofaktoren
- 24. September: Weniger Grippefälle während der Corona-Pandemie
- 22. September: Das Tragen einer Brille könnte das Risiko einer Infektion mit Sars-CoV-2 senken
- 15. September: Weitere Hinweise darauf, dass Rekonvaleszenten-Plasma den Verlauf von Covid-19 günstig beeinflussen kann
- 9. September: Auch bei jungen Patienten machen starkes Übergewicht und Diabetes einen schweren Krankheitsverlauf wahrscheinlicher
- 8. September: Mit lokalen Strategien lassen sich die Kosten für die Eindämmung des Virus minimieren
- 7. September: Ein Grossteil der von Sars-CoV-2 hervorgerufenen Veränderungen im Lungengewebe ist reversibel
- 3. September: Impfstoffkandidaten auf Basis der ersten bekannten Sars-CoV-2-Genome dürften alle jetzt kursierenden Covid-19-Erreger abdecken
- 30. August: Blutverdünnung kann das Sterberisiko bei hospitalisierten Covid-19-Patienten offenbar erheblich senken
- 26. August: Unterschiede in der Immunantwort zwischen Männern und Frauen
- 25. August: Erstmals bestätigen Forscher eine Zweitinfektion mit dem Coronavirus
- 24. August: Die Suche nach dem Zwischenwirt – Marderhunde sind für Sars-CoV-2 empfänglich
- 20. August: 3 von 1000 infizierten Personen im mittleren Alter sterben an Covid-19 – Forscher präsentieren altersabhängige Todesfallraten
- 18. August: Offenbar wenig Einfluss der Schulöffnung in Norwegen auf die Reproduktionszahl
- 14. August: Ein mathematisches Modell erklärt die unterschiedlichen Ausbreitungsmuster von Grippeviren und Sars-CoV-2
- 13. August: Forscher weisen lebensfähige Viruspartikel in winzigen Schwebeteilchen nach
- 10. August: Ein einfacher Test von Schutzmasken mit Smartphone und Laserlicht
- 3. August: Hunde und Katzen können mit Sars-CoV-2 angesteckt werden – bei Schweinen, Hühnern und anderen Nutztieren gibt es keine Hinweise darauf.
- 29. Juli: Herdenimmunität in Mumbai? In drei Slums haben fast 60 Prozent der Bewohner Antikörper gegen Sars-CoV-2
- 29. Juli: Beatmete Covid-19-Patienten haben ein besonders hohes Risiko zu sterben
- 27. Juli: Die einschränkenden Massnahmen haben viele Menschenleben gerettet, wie eine Modellrechnung zeigt
- 24. Juli: Der Superspreader des Corona-Ausbruchs in der Schlachterei Tönnies ist identifiziert
- 22. Juli: Welche Covid-19-Patienten von Cortisonpräparaten profitieren – und wem die Mittel schaden
- 21. Juli: Mehrere Impfstoffe nehmen eine weitere Hürde
- 20. Juli: Gurgeln statt Rachenabstrich und ein umfunktionierter Blutgruppentest – Alternativen zu gängigen Corona-Tests
- 17. Juli: In Wuhan haben unentdeckte Infizierte vermutlich massgeblich zur Ausbreitung von Covid-19 beigetragen
- 16. Juli: Sars-CoV-2 kann das Gehirn direkt und indirekt schädigen
- 15. Juli: Geschmuggelte Schuppentiere tragen ein Sars-CoV-2-ähnliches Virus – und entwickeln eine Atemwegserkrankung
- 14. Juli: Übertragung von Sars-CoV-2 in der Gebärmutter
- 13. Juli: Die Medikamente Hydroxychloroquin und Lopinavir gelangen nicht in ausreichender Konzentration in die Lunge
- 10. Juli: Wissenschafter fordern ein Frühwarnsystem für Zoonosen
- 9. Juli: Alt, männlich, krank, arm, nicht weiss: Das sind die wichtigsten Risikofaktoren für einen fatalen Covid-19-Verlauf
- 8. Juli: Experte fordert, schwangere Frauen als Risikogruppe einzustufen
- 8. Juli: Das Immungedächtnis könnte doch besser sein als angenommen
- 6. Juli: Neandertaler-Gene könnten das Risiko eines schweren Covid-Verlaufs erhöhen
- 2. Juli: Die Lunge von Covid-19-Patienten durchläuft zwei Stadien
- 29. Juni: War das neue Coronavirus schon im März 2019 in Barcelona?
- 30. Juni: Das HIV-Mittel Lopinavir-Ritonavir ist bei Covid-19 nutzlos
- 25. Juni: Covid-19 im globalen Süden: Jung, aber häufig vorerkrankt
- 23. Juni: Machen Mutationen das Coronavirus gefährlicher?
- 22. Juni: Wann kommt die befürchtete «zweite Welle»?
- 19. Juni: Abwasser als Frühwarnsystem für Sars-CoV-2
- 17. Juni: Wie anfällig sind Kinder?
- 16. Juni: Ein altbekanntes Medikament weckt neue Hoffnungen
- 15. Juni: Nur 11 Prozent der Genfer haben sich infiziert
- 12. Juni: Viele haben im Lockdown mehr, aber schlechter geschlafen
- 10. Juni: Traten die ersten Covid-19-Fälle schon im Herbst in Wuhan auf?
- 9. Juni: Weitere Hinweise für die Wirksamkeit von Remdesivir
- 8. Juni: Schützt die Tuberkulose-Impfung vor Covid-19?
- 5. Juni: Zwei prominente Studien zurückgezogen
- 4. Juni: Strategien zur Reduktion von Kontakten
- 3. Juni: Reproduktionsrate in der Schweiz
- 2. Juni: Das Virus befällt zuerst die Nase
- 1. Juni: Maske, Abstand und Visier – was nützt?
15. Dezember: Spieltheoretische Experimente zeigen ein verändertes Verhalten von Jugendlichen
evg. · Die Covid-19-Pandemie trifft nicht alle Schichten der Bevölkerung gleich. Forscher berichten im Journal «PNAS», dass sich das Verhalten von Jugendlichen aus Haushalten mit geringen Einkommen in spieltheoretischen Experimenten verändert habe: Sie verhielten sich im Vergleich zu Messungen vor der Pandemie seltener kooperativ und vertrauten dem Gegenüber weniger.
Bei Jugendlichen aus Haushalten mit höheren Einkommen war dies nicht der Fall. Über die möglichen Gründe für die beobachtete Verhaltensänderung lässt sich nur spekulieren. Zwar wurden die Angehörigen der Jugendlichen im Verlauf der Pandemie häufiger hospitalisiert und auch häufiger arbeitslos, als dies bei Familien mit höheren Einkommen der Fall war. Doch ein statistischer Zusammenhang zwischen diesen beiden Faktoren und der Verhaltensänderung wurde in der vorliegenden Studie nicht gefunden.
Die Autoren sehen in diesen Resultaten einen Hinweis darauf, dass die Covid-19-Pandemie soziale Ungleichheit fördern könnte. Denn Verhaltensökonomen hatten bereits früher über einen statistischen Zusammenhang zwischen prosozialem Verhalten und der Beschäftigungsrate berichtet. Ob die Beschäftigungsrate dabei das prosoziale Verhalten fördert oder umgekehrt, das lässt sich aus jenen Befunden nicht lesen.
6. Dezember: FFP2-Masken schützen laut Forschern deutlich besser vor einer Corona-Infektion als OP-Masken
svt. · Zum Schutz vor der Übertragung von Coronaviren sind Masken ein hervorragendes Mittel – vor allem FFP2-Masken, in geringerem Masse aber auch OP-Masken. Das untermauert jetzt eine Studie von Forschern um Eberhard Bodenschatz vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen, die vor kurzem in den «Proceedings of the National Academy of Sciences» erschienen ist.
Bis anhin empfiehlt das Bundesamt für Gesundheit (BAG) bei grosser Ansteckungsgefahr das Tragen von Hygienemasken. Für den privaten Gebrauch seien Atemschutzmasken (zu diesen zählen auch die FFP2-Masken) nicht notwendig, denn in Alltagssituationen würden sie nicht unbedingt besser schützen, heisst es auf der BAG-Website noch am 6. Dezember.
In der neuen wissenschaftlichen Prüfung schneiden die FFP2-Masken allerdings deutlich besser ab als die Hygienemasken. Da gerade in der Schweiz darüber diskutiert wird, wie der Schutz vor der Pandemie verschärft werden könnte, bietet sich also möglicherweise ein Wechsel in Bezug auf den empfohlenen Maskentyp an.
Die Forscher um Bodenschatz ermittelten für etliche Szenarien des Maskentragens bei einer zwanzigminütigen Begegnung in kürzester Distanz, wie gross jeweils das maximale Ansteckungsrisiko war. Tragen sowohl die infizierte als auch die nicht infizierte Person eine akkurat sitzende FFP2-Maske, beträgt das Risiko höchstens 0,14 Prozent. Streifen hingegen beide Personen OP-Masken passgenau über Mund und Nase, liegt das maximale Ansteckungsrisiko bei 10,4 Prozent, es ist dann also 74-mal grösser als mit FFP2-Masken.
Auch die Frage, welche Rolle es spiele, wie sorgfältig man die Masken an das Gesicht anpasse, haben die Wissenschafter untersucht. Ihr Resultat: Selbst wenn beide FFP2-Masken nur nachlässig getragen werden, schneiden sie – mit einem Infektionsrisiko von 4,2 Prozent – im Vergleich zu zwei perfekt sitzenden Hygienemasken 2,5-mal besser ab.
Die tatsächliche Infektionswahrscheinlichkeit dürfte allerdings deutlich kleiner sein, als es die Resultate der Studie suggerieren – laut Bodenschatz ist sie um den Faktor 10 bis 100 geringer. Das liegt daran, dass die Wissenschafter das maximal mögliche Risiko ermitteln wollten und darum gezielt idealisierte Annahmen getroffen haben. Zum Beispiel vernachlässigten sie, dass die Luft, die an den Maskenrändern vorbeiströmt, noch verdünnt wird, bevor eine andere Person sie einatmet.
Die Studie, die auf umfangreichen Messungen und Berechnungen beruht, hat ein eindeutiges Fazit: Die allgemeine Nutzung von Masken, so schreiben die Autoren, sei die wirksamste Methode, um die Übertragung von Coronaviren zu begrenzen. Das Tragen von FFP2-Masken sei dabei der Verwendung von Hygienemasken vorzuziehen.
18. November: US-Forscher sieht «starke Evidenz, dass ein Markt in Wuhan Ausgangsort der Corona-Pandemie war»
slz. · Der erste bekannte Covid-19-Fall sei eine Verkäuferin von Meeresfrüchten des Huanan Seafood Market in Wuhan gewesen. Bei der Frau seien die Symptome erstmals am 11. Dezember 2019 aufgetreten. Dies schreibt der Evolutionsbiologe Michael Worobey in der Fachzeitschrift «Science». Er hat wissenschaftliche Veröffentlichungen sowie Berichte von chinesischen Behörden, der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und auch von Medien ausgewertet.
Gemäss Worobey ist dagegen der bisher als erster bekannter Fall beschriebene Covid-19-Patient sozusagen eine Falschdatierung. Angeblich soll bei dem Mann bereits am 8. Dezember 2019 Covid-19 diagnostiziert worden sein. Doch zu diesem Zeitpunkt habe sich der Mann wegen Zahnproblemen im Spital behandeln lassen, so zitiert Worobey einen Bericht. Die Covid-19-Symptome seien bei dem Mann jedoch erst am 16. Dezember aufgetreten, sechs Tage später musste er dann ins Spital eingeliefert werden.
Die Analyse der Geschehnisse im Dezember 2019 in Wuhan habe eine starke Evidenz dafür ergeben, dass ein Markt der Ausgangsort der Corona-Pandemie gewesen sei, ist Worobey überzeugt. Für ihn kommt dafür nur der Huanan Seafood Market infrage.
Denn alle der ersten durch Spitalaufenthalte bekanntgewordenen Covid-19-Fälle hätten Händler oder Zulieferer des Huanan Seafood Market betroffen. Oder Verwandte von diesen. Zudem hätten die meisten der 174 Corona-Patienten, die in der Frühphase der Corona-Pandemie in Wuhan entdeckt worden seien, in der Nähe des Marktes gewohnt.
Dass nur gut die Hälfte der frühesten Covid-19-Betroffenen entweder Mitarbeiter oder Besucher des Huanan Seafood Market waren oder Kontakt zu solchen Personen hatten, das ist für ihn kein Gegenargument.
Vielmehr sei genau das zu erwarten, betont er. Denn Sars-CoV-2 verbreite sich bekanntlich sehr schnell und oftmals unbemerkt. Wenn die ersten Infektionsketten ihren Anfang auf dem Markt genommen hätten, dann sei davon auszugehen, dass bereits der dritte oder vierte Infizierte in dieser Kette keinen direkten Kontakt mehr mit einem Mitarbeiter oder Besucher des Marktes gehabt habe.
Doch den handfesten Beweis, dass dasjenige Coronavirus, das die weltweite Pandemie ausgelöst hat, tatsächlich von einem Tier auf dem Huanan Seafood Market stammt, kann Worobey nicht erbringen. Denn der Markt wurde am 1. Januar 2020 geschlossen und desinfiziert, die dort gehaltenen Tiere gekeult. Worobey fordert detaillierte epidemiologische Untersuchungen inklusive genetischer Analysen der in den Patienten in Wuhan vorhandenen Coronaviren. Doch es ist unklar, ob es diese Proben überhaupt gibt.
2. November: Geimpft, aber trotzdem ansteckend – warum das ein Grund mehr für die Schutzimpfung ist
ni. · Schon länger mehren sich die Hinweise darauf, dass die Corona-Impfung zwar sehr gut vor einer schweren, potenziell tödlichen Erkrankung schützt, aber deutlich weniger gut vor einer milden Infektion. Wie oft sich doppelt geimpfte Personen mit Sars-CoV-2 anstecken und das Virus an andere – geimpfte und ungeimpfte – Personen weitergeben, haben nun britische Forscher mit Daten aus dem nationalen Contact-Tracing untersucht – und zwar dort, wo Virusübertragungen besonders häufig vorkommen: im privaten Haushalt.
Wie die vor kurzem in der Fachzeitschrift «The Lancet Infectious Diseases» erschienene Arbeit mit 621 Probanden zeigt, steckte sich in der Studienzeit zwischen September 2020 und September 2021 ein Viertel der doppelt geimpften Personen bei Mitgliedern des gleichen Haushalts an und entwickelte eine milde Erkrankung oder eine Infektion ohne Symptome; bei den ungeimpften Personen lag die Ansteckungsrate mit 38 Prozent etwas höher.
Bei der Infektiosität allerdings scheinen sich Geimpfte und Ungeimpfte nicht wesentlich zu unterscheiden. So haben die untersuchten Geimpften das eingedrungene Virus laut den Studienautoren zwar rascher als Ungeimpfte eliminieren können; die geschätzte Zahl der Coronaviren in der Nase und im Rachen – die sogenannte virale Last – soll bei ihnen aber nach der Ansteckung vergleichbar hohe Werte erreicht haben.
Das dürfte laut den Forschern erklären, weshalb sich die hochansteckende Delta-Variante auch in Ländern mit relativ hoher Impfquote weiter ausbreiten kann. Dieser Sachverhalt spricht aber keinesfalls gegen die Impfung. Denn ihre wichtigste Funktion ist und bleibt die Verhinderung von schweren Krankheitsfällen. Dass die Immunisierung deutlich weniger gut vor einer asymptomatischen oder einer mit milden Symptomen einhergehenden Infektion schützt, sollte bisher Ungeimpfte stark motivieren, sich selber mit der Schutzimpfung vor einer schweren Erkrankung zu schützen. Denn sie können sich im Kontakt mit Geimpften nicht sicher vor einer Ansteckung fühlen. Das ist die eigentliche Botschaft der britischen Studie, die im Hinblick auf die kalten Wintermonate, wenn sich wieder mehr Menschen zu Hause versammeln, eine grosse Bedeutung hat.
28. Oktober: Das Antidepressivum Fluvoxamin reduziert bei Covid-19 das Hospitalisationsrisiko
ni. · Eine grosse Studie aus Brasilien zeigt, dass ein bewährtes und günstiges Medikament gegen Depressionen auch eine Wirkung gegen Covid-19 hat – zumindest wenn die damit behandelte Person aufgrund ihres Alters, bestehender Krankheiten oder Übergewichts ein erhöhtes Risiko hat, nach der Infektion mit dem neuen Coronavirus schwer zu erkranken.
Beim eingesetzten Wirkstoff handelt es sich um Fluvoxamin, ein Antidepressivum aus der Gruppe der sogenannten Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer (SSRI); die Substanz ist in der Schweiz seit 1983 zugelassen. Dass das Mittel auch eine antientzündliche Wirkung hat und damit Patienten mit Covid-19 bei frühzeitiger Gabe von Nutzen sein könnte, war schon aus früheren Beobachtungen und kleineren Studien bekannt. Erst die nun im Fachjournal «The Lancet Global Health» veröffentlichte Arbeit eines brasilianisch-kanadischen Forschungsteams ist aber gross genug und methodisch überzeugend, um daraus konkrete Empfehlungen ableiten zu können.
Von den knapp 1500 in die Studie eingeschlossenen Covid-19-Patienten mit hohem Risiko erhielt die eine Hälfte in den Ambulatorien von verschiedenen Spitälern neben der Standardtherapie während zehn Tagen Fluvoxamin, die andere Hälfte ein gleich aussehendes Placebo. Wie sich zeigte, verschlechterte sich in der Fluvoxamin-Gruppe bei 11 Prozent der Patienten der Zustand in den nächsten 28 Tagen so stark, dass sie hospitalisiert werden mussten oder zumindest eine erhöhte medizinische Betreuung brauchten; in der Placebo-Gruppe lag diese Rate mit 16 Prozent statistisch signifikant höher.
Die Studienergebnisse seien in erster Linie für ärmere Länder mit zu wenig verfügbarem Covid-19-Impfstoff bedeutsam, schreiben Kommentatoren, die an der Studie nicht beteiligt waren. Zudem seien trotz den überzeugenden Ergebnissen noch einige Fragen ungeklärt. So wisse man etwa nicht, wie sich der Effekt von Fluvoxamin auf andere bei Covid-19-Patienten eingesetzte Medikamente wie die monoklonalen Antikörper auswirken würde. Besser, als im Fall einer Erkrankung auf mögliche Arzneimittel zu zählen, ist daher die Anwendung der Corona-Schutzimpfung.
27. Oktober: Tumorpatienten entwickeln schlechteren Impfschutz – sie sollten unbedingt eine Auffrischung erhalten
slz. · Ein Tumorleiden ist ein Risikofaktor für eine schwere Covid-19-Erkrankung. Daher zählten in vielen Ländern Krebspatienten zu der ersten Gruppe der Geimpften. Nun liefert die im Mai 2020 begonnene britische Capture-Studie in der Fachzeitschrift «Nature Cancer» Belege für einen schwächeren Immunschutz als bei Gesunden.
Untersucht wurden 585 Krebspatienten mit einer bösartigen Geschwulst in einem Organ oder mit Blutkrebs. Alle Patienten hatten entweder zwei Dosen der Vakzine von AstraZeneca oder von Biontech/Pfizer erhalten. In der darauffolgenden Zeit untersuchte man ihre Immunantwort.
Dadurch wurde allerdings ihr Immunsystem weniger aktiviert als bei Gesunden. Nur in gut der Hälfte der Tumorpatienten wurden spezifisch gegen die derzeit dominierenden Delta-Varianten gerichtete Antikörper entdeckt. Vor allem bei Patienten mit Blutkrebs schwächelte das Immunsystem, nur ein Drittel von ihnen bildete überhaupt die dringend benötigten Antikörper.
Bei einer Vergleichsgruppe von Gesunden besassen 85 Prozent der Geimpften die spezifischen Antikörper. Bei allen Probanden war die mRNA-Vakzine von Biontech/Pfizer etwas effizienter als der Vektorimpfstoff von AstraZeneca.
Deutlich besser sah es bei der zweiten Verteidigungslinie aus, die ebenfalls nach einer Impfung – und auch nach einer Infektion – vom Immunsystem aufgebaut wird. Neben den Antikörpern werden nämlich auch spezielle T-Zellen gebildet, die von Viren befallene Zellen erkennen und diese umgehend vernichten. Diese zweite Truppe von Verteidigern verhindert zwar nicht eine Infektion. Dafür mindert sie die Schwere einer Erkrankung. Bei knapp 80 Prozent der geimpften Tumorpatienten war eine solche T-Zellen-Antwort feststellbar.
Da selbst doppelt geimpfte Tumorpatienten oftmals nur suboptimal geschützt seien, sollten diese Personen auf jeden Fall baldmöglichst eine Auffrischungsimpfung erhalten, fordern die Autoren, vor allem in Phasen, in denen die Inzidenzen hoch seien und damit das Risiko für eine Ansteckung erheblich sei. In der Schweiz wie auch in Deutschland können Tumorpatienten eine Boosterimpfung bekommen.
Ob Impfdurchbrüche bei Tumorpatienten häufiger sind als in der Normalbevölkerung, konnten die Autoren nicht sagen. Denn während der Datenerhebungsphase seien die Inzidenzen in Grossbritannien deutlich niedriger und die Delta-Variante noch nicht so dominierend gewesen wie jetzt, schreiben sie.
Um das ineffiziente Immunsystem der Krebspatienten zusätzlich anzukurbeln, könnte es vorteilhaft sein, für die Boosterimpfung einen anderen Vakzintyp zu verwenden als bei den ersten zwei Impfungen, so wird spekuliert. Allerdings gibt es zwar erste Hinweise, aber noch keine Beweise, dass diese Strategie erfolgversprechend ist.
14. Oktober: Ein BMI über 35 verdoppelt bei Covid-19 das Risiko für einen potenziell fatalen Krankheitsverlauf
ni. · Dass Übergewicht bei Covid-19 ein wichtiger Risikofaktor für einen schweren Krankheitsverlauf ist, haben Mediziner schon zu Beginn der Pandemie festgestellt, und viele Studien haben dies in der Folge bestätigt. Wie verheerend zu viel Körperfett bei einer Infektion mit Sars-CoV-2 tatsächlich ist, dürften viele dennoch unterschätzt haben. Eine grosse Kohortenstudie aus Schweden spricht nun Klartext.
Für die in der Fachzeitschrift «Plos One» veröffentlichte Arbeit haben Forschende von der Universität Göteborg die Daten von 1649 erwachsenen Covid-19-Patienten aus dem nationalen Intensivmedizin-Register ausgewertet. Die Patienten – drei Viertel von ihnen waren Männer, und das Durchschnittsalter betrug 60 Jahre – waren alle in der ersten Corona-Welle zwischen März und September 2020 auf einer schwedischen Intensivstation behandelt worden.
Wie die Studie zeigt, waren knapp 8 von 10 dieser Patienten übergewichtig; das ist deutlich mehr als in der Allgemeinbevölkerung oder bei anderen Patienten auf Intensivstationen. 4 von 10 Patienten erfüllten sogar die Kriterien einer Adipositas: Sie hatten also einen Body-Mass-Index (BMI) von mehr als 30. Welche Konsequenzen damit verbunden sind, zeigen die Studienergebnisse eindrücklich.
So konnten die Forscher mit statistischen Methoden eine praktisch dosisabhängige Verbindung zwischen dem BMI eines Patienten und seinem Risiko für einen tödlichen oder zumindest stark verlängerten Krankheitsverlauf nachweisen. Bei Patienten mit einem BMI von mehr als 35 – das ist zum Beispiel ein Mann, der 175 Zentimeter gross ist und 108 Kilogramm auf die Waage bringt – war dieses Risiko doppelt so hoch, und zwar unabhängig von Alter und Geschlecht.
Das erhöhte Risiko blieb auch dann noch nachweisbar, wenn die Forscher bei den Patienten andere bekannte Risikofaktoren für einen schweren Krankheitsverlauf wie etwa Bluthochdruck, Diabetes oder Nierenkrankheiten berücksichtigten. Das zeige, schreiben die Studienautoren, dass Übergewicht nicht nur ein Risikofaktor für andere Krankheiten wie Diabetes oder Bluthochdruck sei, sondern bei Covid-19 als unabhängiger Risikofaktor einen schweren Krankheitsverlauf begünstige.
Auf welche Weise das Körperfett das tut, ist laut den Wissenschaftern noch nicht im Detail geklärt. Möglich sei, dass bei den übergewichtigen Patienten die adaptive Immunantwort beeinträchtigt sei. Als metabolisch aktives Organ könne ein Zuviel an Fettgewebe auch die Herz- und Lungenfunktion ungünstig beeinflussen oder das Thromboserisiko erhöhen. Unabhängig vom Mechanismus müsse der BMI bei der Risikobeurteilung von Covid-19-Patienten auf der Intensivstation unbedingt stärker berücksichtigt werden. Zudem sollten adipöse Patienten besonders engmaschig überwacht werden.
22. September: Nach den RNA-Impfstoffen kommen nun auch die DNA-Vakzine
ni. · Indien ist eine Premiere gelungen. Mit dem Produkt ZyCoV-D hat das Land Ende August den weltweit ersten DNA-Impfstoff gegen Covid-19 zugelassen. Gemäss klinischen Studien mit mehr als 28 000 Teilnehmern soll er geimpfte Personen zu 67 Prozent vor einer symptomatischen Infektion schützen. Auch wenn das im Vergleich zu anderen Covid-19-Impfstoffen nicht sehr beeindruckend ist, begrüssen viele Experten die Verfügbarkeit des ersten DNA-Impfstoffs gegen Sars-CoV-2.
Denn DNA-Impfstoffe – diese Technologie wird seit den 1990er Jahren erforscht – besitzen gegenüber anderen genbasierten Vakzinen gewisse Vorteile. So sind sie laut Fachleuten einfacher herzustellen und sind stabiler als etwa die breit eingesetzten mRNA-Corona-Impfstoffe, die oft bei sehr niedrigen Temperaturen gelagert werden müssen. Weltweit werden derzeit rund ein Dutzend weitere DNA-Impfstoffe gegen Covid-19 in klinischen Studien getestet. Welchen Stellenwert sie in der Pandemiebekämpfung haben werden, muss sich aber erst noch zeigen.
ZyCoV-D stammt vom indischen Pharmaunternehmen Zydus Cadila aus Ahmedabad. Der Impfstoff besteht aus ringförmigen DNA-Strängen, sogenannten Plasmiden. Diese enthalten die Erbinformation für das Spike-Protein von Sars-CoV-2 sowie eine Sequenz, die das Ablesen des Gens aktiviert. Anders als die mRNA-Impfstoffe, die – einmal in eine menschliche Zelle aufgenommen – gleich als Anleitung für die Herstellung des Spike-Proteins dienen, müssen die Plasmide der DNA-Vakzine erst in den Kern der Zelle gelangen. Dort wird die Erbinformation vom DNA-Strang in einen mRNA-Strang umgeschrieben. Dieser mRNA-Strang verlässt dann den Zellkern und wird – wie ein mRNA-Impfstoff – als Anleitung für die Spike-Protein-Synthese verwendet.
Anders als die bisherigen Covid-19-Impfstoffe wird ZyCoV-D nicht ins Muskelgewebe gespritzt, sondern direkt unter der Haut deponiert. Das geschieht nicht mit einer Spritze, sondern mithilfe eines speziellen Geräts, das einen feinen Flüssigkeitsstrom mit hohem Druck unter die Haut schiesst. Die Immunisierung sollte damit weniger schmerzhaft sein als eine klassische Injektion. Für einen guten Immunschutz waren bei ZyCoV-D offenbar drei Dosen des Impfstoffs nötig.
20. September: Pfizer/Biontech präsentiert erste positive Impfergebnisse bei Kindern unter 12 Jahren
ni. · Bis jetzt lag die untere Altersgrenze für eine Covid-Impfung bei 12 Jahren. Diese dürfte aber schon bald unterboten werden. Denn Pfizer und Biontech haben am Montag erstmals für ihren RNA-Impfstoff Comirnaty Daten aus einer Zulassungsstudie bei Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren vorgelegt. Und diese sehen gemäss einer Medienmitteilung der Firmen gut aus.
Demnach war die doppelte Impfung auch bei dieser Altersgruppe gut verträglich und führte zu einer vergleichbar hohen Antikörperantwort wie bei den früher getesteten Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Im Gegensatz zu diesen erhielten die Kinder zwischen 5 und 11 Jahren nur ein Drittel der bei älteren Personen eingesetzten Impfdosis (10 statt 30 Mikrogramm).
Wie die Unternehmen schreiben, wollen sie die Studienresultate so bald wie möglich bei der amerikanischen, der europäischen und weiteren Zulassungsbehörden weltweit einreichen. «Wir freuen uns, dass wir den Zulassungsbehörden vor Beginn der Wintersaison Daten für diese Gruppe von Kindern im Schulalter vorlegen können», wird Ugur Sahin, CEO und Mitbegründer von Biontech, in der Medienmitteilung zitiert.
Die neuen Ergebnisse stammen aus einer Studie mit 2268 Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren. Parallel zu dieser Altersgruppe laufen auch Impftests in den USA und mehreren europäischen Ländern mit Kindern ab dem 6. Lebensmonat bis zum 4. Lebensjahr. Sie erhalten mit 3 Mikrogramm eine noch geringere Impfdosis als die älteren Kinder. Die Resultate bei diesen jüngsten Kindern werden gegen Ende des Jahres erwartet.
16. September: Experten halten kurzfristigen Einfluss der Impfung auf den weiblichen Zyklus für möglich
ni. · Seit breit gegen Covid-19 geimpft wird, klagen etliche Frauen nach der Immunisierung über eine verstärkte Regelblutung oder Zwischenblutungen. Weniger häufig wird nach der Impfung über einen verlängerten oder verkürzten Menstruationszyklus berichtet.
Wegen solcher Meldungen, die vor allem in den sozialen Netzwerken kursieren, mit denen aber auch viele praktizierende Ärztinnen und Ärzte konfrontiert sind, hat das einflussreiche «British Journal of Medicine» («BMJ») am Donnerstag in einem Kommentar mehr Studien zu diesem Thema gefordert. Damit solle Klarheit geschaffen werden. Denn die Verunsicherung führe dazu, dass sich viele Frauen nicht impfen liessen.
Das «BMJ» weist gleichzeitig darauf hin, dass der Sicherheitsausschuss der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) Anfang August keinen Beleg für einen kausalen Zusammenhang zwischen den eingesetzten Impfstoffen und den Beschwerden bei der Monatsregel gefunden habe. Auch die EMA fordert von den Impfstoffherstellern aber weitere Daten.
Auch wenn der Beweis für eine kausale Verknüpfung noch fehlt, ist es für Fachleute vorstellbar, dass die Corona-Impfung Auswirkungen auf die Stärke und die Regelmässigkeit der Menstruation haben kann. Weil der weibliche Zyklus aber von einer Vielzahl körperlicher und psychischer Einflüsse abhängt, ist es schwierig, hier eine einzelne Ursache dingfest zu machen. Dass die Immunisierung eine Rolle spielen könnte, suggerieren auch vereinzelte Beobachtungen, wonach Frauen nach der Menopause und Transmänner, die normalerweise keine Periode haben, nach der Impfung Blutungen erlebten.
Wie das «BMJ» schreibt, dürften die von den Frauen beschriebenen Menstruationsprobleme eher durch die Immunreaktion nach der Impfung denn durch einzelne Bestandteile in der Corona-Vakzine ausgelöst werden. Dies deshalb, weil die gemeldeten Zyklusveränderungen nicht auf einzelne Impfstoffe beschränkt sind.
Für Experten ist es beispielsweise vorstellbar, dass die Verbindung zwischen Impfung und veränderter Regel über Immunzellen oder Hormone vermittelt wird, die beim zyklischen Auf- und Abbau der Gebärmutterschleimhaut eine Rolle spielen. Andere Fachleute betonen, dass der Zeitpunkt des Eisprungs durch Immun- und Entzündungsprozesse beeinflusst werde. Auf diese Weise könnten nicht nur Fieber, Impfungen und Krankheiten Dauer und Stärke der Periode verändern. Auch Hochleistungssport, die Zeitverschiebung bei einer Reise und viele andere Formen von körperlichem Stress kämen als Ursache infrage.
Die meisten Fachleute betonen, dass die nach der Corona-Impfung beobachteten Unregelmässigkeiten in den allermeisten Fällen nur einen oder wenige Menstruationszyklen beträfen. In diesen Fällen gebe es keinen Grund zur Sorge. Insbesondere seien nach der Corona-Impfung keine länger dauernden negativen Effekte auf die Menstruation oder die Fruchtbarkeit bekannt. Letzteres wird aber gerade in sozialen Netzwerken immer wieder fälschlicherweise behauptet.
10. September: Corona-Impfung schützt Schwangere und Kind
slz. Die Ständige Impfkommission (Stiko) in Deutschland hat am Freitag für ein Corona-Impfung für alle Schwangeren ausgesprochen. Schwangeren und Stillenden, die bis jetzt nicht oder unvollständig geimpft seien, werde eine Impfung mit zwei Dosen eines mRNA-Impfstoffs empfohlen, heisst es darin. Ebenso werden alle Frauen im gebärfähigen Alter aufgefordert, sich impfen zu lassen.
Es habe sich erstens in den letzten Wochen gezeigt, dass Schwangerschaft ein Risikofaktor für eine schwere Covid-19-Erkrankung sein könne, so erläutert Marianne Röbl-Mathieu, Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe in München und Mitglied der Ständigen Impfkommission die neue Empfehlung. Zweitens habe sich die Impfung auch für Schwangere als sicher erwiesen.
Eine ausführliche Einschätzung finden Sie hier.
3. September: Genesene haben einen etwas besseren Immunschutz als Geimpfte – aber Impfen ist trotzdem sinnvoll
slz. · Personen, die in Israel im Januar oder Februar dieses Jahres mit der Pfizer/Biontech-Vakzine geimpft worden waren, hatten im Sommer ein dreizehnfach so hohes Risiko, sich mit Sars-CoV-2 zu infizieren, als Menschen, die im Winter eine natürliche Corona-Erkrankung durchgemacht hatten. Erfasst wurden fast ausschliesslich Daten zu Impfdurchbrüchen beziehungsweise Reinfektionen mit der Delta-Variante, da diese ab Juni in Israel dominant war.
Die noch nicht von Experten begutachtete Studie bestätigt zum einen frühere Beobachtungen, dass die Schutzwirkung der Impfung über die Monate hinweg abnimmt. Zum anderen liefert sie Hinweise, dass der Immunschutz nach einer natürlichen Infektion länger anhalten könnte.
Eine ebenfalls kürzlich präsentierte und auch noch nicht begutachtete britische Studie kam allerdings zu dem Ergebnis, dass innert sieben Monaten der Immunschutz bei Geimpften und Genesenen ähnlich hoch war. Noch ist unklar, ob und welche Unterschiede zwischen den Studienteilnehmern in Israel und Grossbritannien es gab, die diese abweichenden Ergebnisse erklären könnten.
In der israelischen Studie wurde zudem die Zahl der Hospitalisationen erfasst, sie war bei den Genesenen etwas geringer als bei den Geimpften. Da jedoch insgesamt sehr wenige Personen ins Spital mussten, lässt sich keine statistisch verlässliche Aussage darüber machen, inwieweit eine durchgemachte Infektion besser vor schweren Erkrankungen schützt als eine Impfung. Diverse andere Erhebungen haben gezeigt, dass der Schutz vor einer schweren Erkrankung nach einer Impfung auch im Laufe der Zeit deutlich über 90 Prozent beträgt.
Tatsache bleibt, dass im Beobachtungszeitraum eine natürliche Infektion die israelischen Probanden etwas besser schützte als eine Impfung. Einen nochmals etwas erhöhten Immunschutz vermittelten eine Infektion plus eine Impfdosis. In den kommenden Monaten wird sich zeigen, ob auch die umgekehrte Reihenfolge, also erst eine Impfung und dann eine milde Infektion, diesen höheren Schutzeffekt hat.
Die Daten seien allerdings kein Argument gegen die Impfung, das betonen sowohl die Autoren der Studie als auch diverse Experten, zum Beispiel gegenüber dem Fachmagazin «Science». Denn die Risiken, die eine natürliche Infektion gerade für ältere Menschen oder solche mit Vorerkrankungen mit sich bringt, sind um ein Vielfaches grösser (und auch deutlich grösser als der Faktor 13) als jene, die von der Impfung ausgehen. So hat die natürliche Infektion ein sehr viel höheres Todesrisiko. Zudem kennt man bis anhin nur Fälle von Long Covid nach einer Infektion, nicht jedoch nach einer Impfung. Die Studie ist also kein Argument, jetzt eine Corona-Party zu feiern.
Sie zeigt jedoch, dass Genesene einen wichtigen Teil der immunen Bevölkerung darstellen. Somit sollte man nicht nur auf die Anzahl der Geimpften schauen, wenn man angesichts steigender Fallzahlen zum Beispiel das Risiko von Spitalüberlastungen in einer Region abschätzen muss.
Und die Daten können auch die Ängste vor Impfdurchbrüchen mindern. Denn es kam in der gesamten Studienpopulation nur bei 1,5 Prozent der Geimpften zu einer Sars-CoV-2-Infektion.
28. August: Doppelt so hohes Risiko für eine Krankenhauseinweisung bei Infektionen mit Delta
(dpa) · Das Risiko für eine Krankenhauseinweisung ist bei einer Infektion mit der Delta-Variante des Coronavirus laut einer Studie gut doppelt so hoch als bei der Alpha-Variante. Die in der Fachzeitschrift «The Lancet Infectious Diseases» veröffentlichten Ergebnisse lassen sich vor allem auf das Risiko für Ungeimpfte beziehen.
Die Forschenden von der Universität Cambridge und Public Health England werteten für ihre Untersuchung mehr als 40 000 Corona-Fälle in England zwischen Ende März und Ende Mai 2021 aus. Knapp 9000 gingen auf Delta zurück, rund 35 000 auf Alpha. Dazu ins Verhältnis gesetzt betrachteten sie einerseits die Zahl der Krankenhauseinweisungen und andererseits die Hospitalisationen und Besuche im Notfall zusammengenommen.
Nachdem sie die Daten um Faktoren wie Alter und demografische Merkmale bereinigt hatten, stellten sie bei einer Infektion mit Delta ein im Mittel 2,26-fach höheres Risiko – also ein mehr als doppelt so hohes – für eine Krankenhauseinweisung innerhalb von zwei Wochen nach dem Test fest. Das Risiko, dass Patienten innerhalb von 14 Tagen eine Notaufnahme aufsuchen oder stationär aufgenommen werden müssen, war demnach bei Delta 1,45-fach höher als bei Alpha.
Unter den mehr als 40 000 untersuchten Fällen in der Studie waren nur 1,8 Prozent vollständig Geimpfte, was die Forscher als erneute Bestätigung für einen sehr wirksamen Schutz der Impfstoffe interpretieren. Wegen der wenigen Daten können sie keine Aussagen dazu machen, ob ein höheres Risiko für eine schwere Erkrankung auch bei Geimpften vorhanden ist.
Als Schwächen ihrer Studie geben die Autoren an, dass sie keine Daten zu den Vorerkrankungen ihrer Patienten zur Verfügung hatten. Ausserdem sei es möglich, dass sich die Regeln für Krankenhauseinweisungen während der Versuchsperiode geändert haben. Die Forscher versuchten zumindest, diese Faktoren in ihren Berechnungen möglichst zu minimieren.
26. August: Ungenaue Antigen-Schnelltests – jeder dritte Infizierte wird übersehen
ni. · Testen, testen, testen: So lautet das bekannte Pandemie-Mantra. Dazu werden seit langem auch Antigen-Schnelltests eingesetzt. Denn diese sind gegenüber dem besonders verlässlichen PCR-Test viel schneller, günstiger und praktischer in der Anwendung. Aber sind sie auch zuverlässig? Nicht so, wie man sich das wünschen würde. Zu diesem Schluss kommt jedenfalls eine Studie aus Bern.
Die Wissenschafter unter der Leitung von Michael Nagler vom Institut für Klinische Chemie am Inselspital haben einen verbreiteten Antigen-Schnelltest der Firma Roche einem direkten Vergleich mit dem PCR-Test unterzogen – und das unter realen Bedingungen, wie sie am Inselspital herrschen. Damit liegen laut den Studienautoren erstmals zuverlässige Ergebnisse eines solchen Vergleichs vor. Andere Antigen-Schnelltests dürften ihrer Meinung nach nicht besser abschneiden.
Die Stichprobe umfasste 1465 Personen, von denen 141 mit der Goldstandard-Messmethode PCR als infiziert identifiziert wurden. Mit dem Antigen-Schnelltest liessen sich dagegen nur 95 Infektionen nachweisen. Das heisst, wie die Berner Forscher im «International Journal of Infectious Diseases» schreiben, dass mit dem Antigen-Schnelltest nur zwei von drei PCR-positiven Personen identifiziert werden konnten. Noch grösser war der Fehler bei symptomfreien Infizierten. Hier erkannte der Schnelltest nur 44 Prozent der PCR-positiven Personen.
Diese Resultate weichen somit erheblich von den Herstellerangaben ab. Roche schreibt auf ihrer Website, dass die Zuverlässigkeit ihres Antigen-Schnelltests in zahlreichen unabhängigen Studien validiert worden sei. Die Sensitivität gibt Roche mit 95,5 Prozent und die Spezifität mit 99,2 Prozent an. Demgegenüber ermittelten die Berner Forscher in ihrer Studie eine Test-Sensitivität von 65,3 Prozent. Das heisst, zwei von drei Infizierten werden richtig erkannt; einer von drei wird fälschlicherweise als nicht infiziert beurteilt. Die Spezifität ist mit 99,9 Prozent unbestritten. Das heisst, mit dem Test werden Personen ohne Infektion zuverlässig als solche erkannt.
Für Fachleute kommt diese Diskrepanz nicht ganz unerwartet. Denn bei den Herstellerangaben handelt es sich stets um eine technische Evaluation der Testgenauigkeit. Hier geht es um die Frage: Erkennt der Test ganz eindeutige Positivproben als positiv und ganz eindeutige Negativproben als negativ? In der Realität ist es komplexer. Hier variieren die Patienten und ihre Proben punkto Zeitpunkt und Schwere der Infektion erheblich. Das führt unweigerlich zu schlechteren Testergebnissen.
Was dieser Fehler in der gegenwärtigen Pandemie bedeuten könnte, haben die Forscher abgeschätzt. Bei derzeit rund 130 000 Schnelltests pro Woche dürften 12 400 Personen fälschlicherweise ein negatives Testergebnis erhalten. Diese Personen würden sich danach sicher fühlen und möglicherweise Familienfeiern, Konzerte und Fussballspiele besuchen, so wird Nagler in einer Medienmitteilung des Berner Inselspitals zitiert. «Potenziell besteht somit das Risiko, dass Antigen-Tests die Pandemie verstärken, anstatt sie zu bremsen», sagt der Studienleiter.
Laut Nagler zeigt die Arbeit der Forschergruppe, dass Antigen-Schnelltests nur bedingt dazu geeignet sind, eine Sars-CoV-2-Infektion zuverlässig auszuschliessen. Die zur Verfügung stehenden Antigen-Schnelltests sollten daher mit Vorbehalt eingesetzt werden. Dabei gilt es aber auch zu berücksichtigen, dass der Test bei besonders infektiösen Personen mit hoher Viruslast im Nasen-Rachen-Raum zuverlässiger ist als bei Personen mit wenigen Viren.
19. August: Forscher entdecken Schlüssel für eine Super-Immunität
ni. · Ein Vorgänger-Virus des heutigen Pandemie-Erregers führte 2002/03 zum Sars-Ausbruch mit über 8000 infizierten Personen; mehr als 700 von ihnen starben. Wer den damaligen Ausbruch überlebte, hat offenbar jetzt gewisse Vorteile, wie eine Studie aus Singapur nahelegt. Zwar sind diese Personen nicht per se gegen Covid-19 geschützt. Doch nach einer Immunisierung gegen das jetzt zirkulierende Coronavirus entwickeln sie eine ungewöhnlich breite Immunität gegen verschiedene Coronaviren.
Diesen Effekt hat das Team von Lin Fa Wang von der National University of Singapore jedenfalls bei acht Sars-Überlebenden aus Singapur nachweisen können. Bei den meisten seien auch 17 Jahre nach der Infektion noch neutralisierende Antikörper gegen den ehemaligen Sars-Erreger im Blut nachweisbar gewesen, schreiben die Wissenschafter in der Fachzeitschrift «The New England Journal of Medicine». Gegen das derzeitige Sars-CoV-2 dagegen fanden die Forscher vor der Impfung keine oder nur sehr wenige wirksame Antikörper.
Das änderte sich nach zwei Dosen mit dem RNA-Impfstoff von Pfizer/Biontech eindrücklich. Jetzt hatten alle acht Probanden hohe Konzentrationen von Antikörpern, die im Reagenzglas den Sars- und den Covid-19-Erreger bekämpfen konnten. Besonders interessant: Der Booster-Effekt auf die Antikörper gegen den Sars-Erreger war unabhängig vom Antikörper-Spiegel vor der Impfung.
Die Forscher erklären sich den beobachteten doppelten Effekt der Impfung damit, dass die für die Antikörper zuständigen Immunzellen (B-Zellen) auf jedes Virus mit einem Potpourri aus unterschiedlichen Antikörpern reagieren. Einige dieser Eiweissstoffe dürften dann auch gegen verwandte Viren eine gewisse Wirkung entfalten. Wenn das stimmt, könnte die Covid-19-Impfung bei den Sars-Überlebenden die spezifischen Immunzellen stärken und so zu einer besonders breiten Immunität führen, die sogar über den Sars- und den Covid-19-Erreger hinausgeht.
Um ihre Hypothese zu testen, untersuchten die Wissenschafter die Antikörper-Antworten von fünf verschiedenen Personengruppen: neben den Sars-Überlebenden mit Covid-19-Impfung waren das Sars-Überlebende ohne Impfung; Ungeimpfte mit gegenwärtiger Erkrankung an Covid-19; Geimpfte, die zuvor Covid-19 hatten, und schliesslich Personen ohne Kontakt mit Sars-CoV-2.
Wie sich zeigte, waren die geimpften Sars-Überlebenden die einzige Gruppe, deren Antikörper im Reagenzglas zehn verschiedene Coronaviren neutralisieren konnten. Darunter waren nicht nur alle bisherigen Varianten von Sars-CoV-2, sondern auch solche, die erst noch entstehen könnten. So war das Immunsystem dieser Personen auch gegen fünf Coronaviren gewappnet, die derzeit in Fledermäusen und Schuppentieren zirkulieren, in Zukunft aber auch für den Menschen gefährlich werden könnten.
An der Studie unbeteiligte Forscher sehen die Arbeit als Beweis dafür, dass eine breit wirksame Impfung gegen nicht ganz so eng verwandte Coronaviren gelingen könnte. So sind der ehemalige Sars-Erreger und das heutige Sars-CoV-2 nur zu etwa 80 Prozent identisch. Beide dringen aber, wie auch andere potenziell gefährliche Coronaviren, über den gleichen Rezeptor in die menschliche Zelle ein. Laut Wang und seinen Kollegen könnte ihre Studie zeigen, dass die Kombination von zwei verschiedenen Coronaviren – beziehungsweise deren Spike-Protein – möglicherweise ausreicht, um die erhoffte breite Immunität zu erzeugen. Bisherige Forschungsprojekte mit dem Ziel einer universalen Corona-Impfung arbeiteten mit deutlich mehr Viren.
17. August: Bei längerem Impfintervall generiert die Pfizer/Biontech-Vakzine eine bessere Antikörperantwort
kus. · Ein längeres Intervall zwischen der ersten und der zweiten Dosis der Pfizer/Biontech-Vakzine erzeugt laut britischen Forschern eine bessere Immunantwort als ein Abstand von nur drei bis vier Wochen. In der noch nicht extern von Fachleuten begutachteten Studie generierte die Impfung bei einem längeren Abstand zwischen den beiden Dosen doppelt so viele neutralisierende Antikörper. Eine weitere Komponente des Immunsystems, die sogenannten T-Zellen, war dagegen etwas reduziert. Diese Zellen lagen dann aber vermehrt in einer Form vor, die günstiger für die «Haltbarkeit» des Impfschutzes sein könnte.
Dieser ist allerdings nach nur einer Impfung gegenüber der Delta-Variante von Sars-CoV-2 recht schwach, was einen zu grossen Abstand zwischen den beiden Impfdosen risikoreich macht. Dies sei gegen den etwas besseren Immunschutz nach einer Verlängerung des Impfintervalls abzuwägen, mahnen die Wissenschafter. Denn bereits nach dem kürzeren (empfohlenen) Abstand schützen zwei Dosen zuverlässig – die etwas bessere Reaktion ist eher das Sahnehäubchen obendrauf.
Der Unterschied zwischen einer und zwei Dosen war bei anderen Varianten von Sars-CoV-2 weniger stark ausgeprägt als bei Delta. Grossbritannien hatte deshalb Anfang Jahr, als die Delta-Variante noch kein Thema war, beschlossen, den Abstand zwischen den Impfungen von den empfohlenen vier auf bis zu zwölf Wochen auszudehnen, um rasch mehr Personen schützen zu können. Da ein Teil der Bevölkerung mit dem regulären Abstand geimpft wurde, erlaubt diese Massnahme, die Auswirkungen unterschiedlich langer Impfabstände zu vergleichen.
Die nun publizierte Untersuchung erfolgte im Rahmen der Pitch-Studie, die die Reaktion des Immunsystems auf die Impfung im Detail untersucht. Wie sich dabei zeigte, sinkt die Zahl der Antikörper nach einem ersten Höhepunkt einige Wochen nach der ersten Impfung deutlich. Trotzdem bestand – gegenüber den vor der Delta-Variante verbreiteten Sars-CoV-2-Varianten – weiterhin ein substanzieller Infektionsschutz. Die Forscher vermuten, dass dies an den sogenannten T-Zellen liegt, einer weiteren Komponente der Immunantwort nach der Impfung. Denn diese blieben im Gegensatz zu den Antikörpern stabil.
Dass Grossbritannien bessere Wirksamkeiten der doppelten Impfung gegenüber Delta verzeichnet als beispielsweise Israel, lässt sich mit der besseren Immunantwort auf die verzögerte zweite Dosis allerdings nicht erklären. Hier dürfte laut Experten vor allem eine Rolle spielen, wie lange die vollständige Immunisierung zurückliegt. Denn der Impfschutz nimmt im Laufe der Zeit bekanntermassen ab, und Israel hatte sehr früh grosse Teile der Bevölkerung vollständig geimpft. Auch bei einer verzögerten zweiten Dosis wird der Impfschutz mit der Zeit geringer. Setzt er allerdings auf einem höheren Niveau ein, dürfte er etwas länger anhalten.
4. August: Kinder mit Covid-19 im Durchschnitt nach sechs Tagen gesund
(dpa) Kinder mit Covid-19-Symptomen sind einer Studie zufolge im Durchschnitt nach sechs Tagen wieder gesund. Das berichten britische Forscher in einer Studie im Fachmagazin «The Lancet Child & Adolescent Health». Nach eigenen Angaben liefern die Autoren, die unter anderem am King’s College in London forschen, damit eine erste breit angelegte Untersuchung, die Erkenntnisse zu symptomatisch an Covid-19 erkrankten Kindern ermöglicht.
Basis der Untersuchung waren die von Eltern oder anderen Erziehungsbeauftragten eingetragenen Symptome, die über eine App nach einem positiven Test gemeldet wurden. In die Auswertung flossen die Krankheitsverläufe von 1734 Kindern zwischen 5 und 17 Jahren ein, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden und Krankheitssymptome zeigten. Im Schnitt hatten die erkrankten Kinder drei Symptome – zu den häufigsten zählten Müdigkeit, Kopfschmerzen und der Verlust von Geschmacks- oder Geruchssinn.
Selten kam es vor, dass Kinder auch noch vier Wochen nach ihrer Infektion oder länger Symptome zeigen – in der Untersuchung war das bei 4,4 Prozent der Fall. Nach acht Wochen verspürten noch weniger als 2 Prozent der Kinder Symptome. «Es ist beruhigend, dass die Zahl der Kinder, die lange unter Covid-19-Symptomen leiden, sehr niedrig ist», wird Hauptautorin Emma Duncan in einer «Lancet»-Mitteilung zitiert.
Ältere waren etwas länger krank – im Schnitt sieben Tage – als die Fünf- bis Elfjährigen, bei denen die Symptome im Mittel fünf Tage dauerten. Auch der Anteil jener Heranwachsenden, die noch nach mehr als vier Wochen Symptome spürten, lag mit 5,1 Prozent unter den älteren etwas höher als bei den jüngeren (3,1 Prozent).
Die Autoren räumen als Schwäche ihrer Studie ein, dass die Symptome nicht überprüft oder verglichen werden konnten. Somit spiele die subjektive Einschätzung der Eltern eine grosse Rolle.
Der Untersuchungszeitraum lief bis Ende Februar. Daher ist unklar, ob die Ergebnisse auf die Delta-Variante des Coronavirus übertragen werden können. Diese wurde zunächst in Indien entdeckt und verbreitete sich erst ab dem Frühjahr von Grossbritannien aus über Europa.
3. August: Genetische Risiken für schwere Covid-19-Verläufe
evg. · Wie ein Mensch auf Sars-CoV-2 reagiert, ist auch von seiner genetischen Ausstattung beeinflusst. Neueste Forschungsergebnisse haben 13 genetische Varianten identifiziert, die eine Infektion begünstigen oder einen schweren Krankheitsverlauf wahrscheinlicher machen. Die Resultate wurden in der Fachzeitschrift «Nature» publiziert.
In die Analyse sind Daten einer grossen Menge von DNA-Abschnitten eingeflossen. Dadurch konnten Forscher nicht nur Basenfolgen untersuchen, deren Beteiligung an der Erkrankung bereits vermutet wird. Andrea Ganna, Mitautor der Studie und Forscher an der Universität Helsinki, teilt auf Anfrage mit, dass auch Unerwartetes gefunden worden sei, beispielsweise eine Position auf Chromosom 3, die mit einem schweren Covid-19-Verlauf assoziiert zu sein scheine. Noch ist unklar, wie dieser DNA-Abschnitt die Krankheit beeinflusst. Zudem bestätigte die Studie, dass Gene, die die Immunreaktion und die Lungenfunktion beeinflussen, einen schweren Verlauf der Erkrankung begünstigen können.
Die vorliegende Studie untersuchte bereits vorhandene, unabhängig erstellte Datensätze in einer sogenannten Metaanalyse. Dies war dank einer gemeinsamen Datennutzungsinitiative der Universität Helsinki und des Broad Institute in den USA möglich. Ein Vorteil dieses Vorgehens besteht darin, dass die Studie die Genome von Populationen unterschiedlicher genetischer Abstammung integrieren konnte, was die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf die gesamte Bevölkerung erhöht.
Die Studienresultate können der Entwicklung von zielgerichteten Medikamenten gegen die Krankheit dienen. Sie erlauben nicht, eine Vorhersage darüber zu treffen, ob jemand sich infizieren oder schwer an Covid-19 erkranken könnte, wie dies bei Risikofaktoren wie Alter, Übergewicht oder Diabetes der Fall ist. Allerdings könnten die Forschungsresultate in Zukunft zur Berechnung des genetischen Risikoprofils eines Patienten herangezogen werden.
29. Juli: Beeinflusst Covid-19 die Denkfähigkeit nachhaltig?
evg. · Der Begriff «Long Covid» bezeichnet anhaltende Beschwerden nach einer Corona-Infektion. Patienten berichten beispielsweise von depressiven Symptomen und Energiemangel. Auch von kognitiven Beschwerden wird berichtet. Beispielsweise klagen Betroffene darüber, sich nicht richtig konzentrieren oder «nicht richtig denken» zu können. Erfahrungsberichte einzelner Patienten wurden bereits mehrfach in Fachzeitschriften dokumentiert.
Ob kognitive Tests diese Beschwerden fassen können und sich Unterschiede zu niemals infizierten Personen statistisch belegen lassen, haben Forscher am Imperial College London untersucht. In einem Online-Test haben mehr als zehntausend von Covid-19 genesene Personen anspruchsvolle Denkaufgaben gelöst.
Tatsächlich zeigte sich, dass ihre Leistung signifikant schlechter war als diejenige einer Vergleichsgruppe, die nicht mit Sars-CoV-2 infiziert gewesen war. Insbesondere die Fähigkeit, Planungs-und Problemlösungsaufgaben zu meistern, war verringert. Diese Beeinträchtigung war zudem statistisch unabhängig von anderen Beschwerden wie Müdigkeit, Angst und Depressionen. Das bedeutet, dass von Patienten berichtete Beschwerden im Denken durchaus mithilfe von kognitiven Tests fassbar sind.
Dass ein schwerer Krankheitsverlauf mit Hospitalisierung und Beatmung gerade bei älteren Patienten lange Erholungszeiten und auch länger anhaltende kognitive Beeinträchtigungen mit sich bringen kann, war bereits früher berichtet worden, unter anderem in der Fachzeitschrift «Neuropsychopharmacology».
Hingegen war für die Forscher aus London überraschend, dass auch die nicht hospitalisierten Patienten in den kognitiven Tests signifikant schlechtere Leistungen zeigten als die Vergleichsgruppe – wenn auch in geringerem Ausmass als die hospitalisierten Patienten. Denn eine Studie aus Italien hatte nach milden Verläufen einer Covid-19-Erkrankung trotz Symptomen wie Stress, Angst und Depressionen keine kognitiven Defizite gefunden. Doch dies könnte auch an der vergleichsweise geringen Anzahl untersuchter Personen in der italienischen Studie liegen.
Ein kausaler Zusammenhang zwischen der Infektion und der kognitiven Beeinträchtigung ist mit der vorliegenden Studie noch nicht belegt. Denn dafür hätten die Patienten nicht nur nach, sondern auch vor einer Infektion getestet werden müssen. Allerdings haben die Forscher dies so gut wie möglich in ihrer statistischen Analyse berücksichtigt.
Die vorliegenden Studienresultate sind ein Hinweis darauf, dass eine Infektion mit Sars-CoV-2 das Denken beeinträchtigen könnte. Noch ist unklar, wie die gemessenen Unterschiede und die von Betroffenen berichteten Beschwerden genau zusammenhängen.
Interessant wäre zu wissen, ob es die gemessenen Unterschiede in der Problemlösungsfähigkeit sind, die für den Einzelnen im Alltag wahrnehmbar und einschränkend sind. Denn durch die grosse Anzahl untersuchter Personen in der Studie aus England können bereits kleinste Unterschiede statistisch signifikant werden. Weitere Studien sollen die Ursachen der anhaltenden psychischen und kognitiven Beschwerden erforschen und untersuchen, ob sich die Erkrankten mit der Zeit vollständig erholen.
Hier listen wir ältere Blogbeiträge auf – so finden Sie schneller, was Sie suchen.
- 22. Juli: Impfungen mit Pfizer und AstraZeneca sind auch gegen Delta-Variante hochwirksam
- 28. Juni: Wie stark beeinflussen die Jahreszeiten die Ausbreitung des Coronavirus?
- 10. Juni: AstraZeneca-Impfstoff mit leicht erhöhtem Risiko von Blutungsstörungen
- 2. Juni: Begünstigt die Corona-Impfung bei jungen Männern eine Herzmuskelentzündung?
- 25. Mai: Spürhunde erkennen Virus mit einer Genauigkeit von bis zu 94 Prozent
- 21. Mai: Leicht erhöhtes Risiko für Babys kurz vor der Geburt
- 18. Mai: Forscher schätzen, welche Antikörperkonzentrationen mit Schutz vor Sars-CoV-2-Infektion oder schwerer Erkrankung korrelieren
- 7. Mai: Ein Biomarker erkennt schwere Covid-19-Verläufe
- 3. Mai: Wissenschafter identifizieren einen Antikörper, der gegen alle bisher bekannten Mutationen von Sars-CoV-2 effektiv ist
- 1. April: Pfizer/Biontech-Impfstoff soll auch bei 12- bis 15-Jährigen gut wirksam sein
- 25. März: Die Corona-Impfung ist vor einer Operation besonders sinnvoll
- 23. März: Britische Forscher identifizieren erste rekombinante Sars-CoV-2
- 16. März: Höheres Sterberisiko bei einer Infektion mit der britischen Variante von Sars-CoV-2
- 9. März: Mehr Coronavirus-Infektionen bei stärkerem Pollenflug
- 3. März: Viele Covid-19-Patienten entwickeln ein Post-Covid-Syndrom
- 26. Februar: Auch in den USA tauchen neue Varianten von Sars-CoV-2 auf
- 24. Februar: Bereits nach einer Dosis Impfstoff sinkt das Risiko einer Hospitalisierung wegen Sars-CoV-2 erheblich
- 21. Februar: Die Pfizer/Biontech-Vakzine soll Ansteckungen mit Sars-CoV-2 zu fast 90 Prozent verhindern
- 19. Februar: Forscher vermuten, dass das Ausmass der Corona-Pandemie in afrikanischen Ländern deutlich unterschätzt wird.
- 12. Februar: Wer sich trotz einer ersten Impfung mit Corona infiziert, produziert offenbar weniger Viren – und könnte deshalb weniger ansteckend sein
- 11. Februar: Aerosol-«Superspreader» – das Alter und das Gewicht sind ausschlaggebend
- 10. Februar: Das Thromboserisiko bleibt bei Covid-19 zwei Monate lang erhöht
- 5. Februar: Bei Personen, die schon eine Sars-CoV-2-Infektion durchgemacht haben, könnte eine Impfdosis reichen
- 2. Februar: Der AstraZeneca-Impfstoff ist im Tierversuch auch als Nasenspray wirksam
- 27. Januar: Die Verbreitungsgebiete von Fledermäusen «überbrücken» die Strecke zwischen dem Fundort des nächsten Verwandten von Sars-CoV-2 und Wuhan
- 21. Januar: Modellrechnung zeigt: Eine gezielte Teststrategie könnte die Quarantäne in einigen Fällen unnötig machen
- 11. Januar: Versammlungsverbote und Schulschliessungen reduzieren die Mobilität besonders effizient
- 8. Januar: Eine wichtige Veränderung der stärker ansteckenden Sars-CoV-2-Varianten mindert die Wirkung der Impfung von Pfizer/Biontech nicht
- 7. Januar: Personen mit der neuen Virusvariante haben vermutlich eine höhere Virenlast
- 31. Dezember: Warum Bluthochdruck das Risiko für einen schweren Verlauf von Covid-19 erhöht
- 30. Dezember: Coronavirus kann bei Kindern zu starker Entzündungsreaktion führen
- 30. Dezember: Grossbritannien und Argentinien lassen Corona-Impfstoff von AstraZeneca zu
- 26. Dezember: Wie die Stärken und Schwächen verschiedener Corona-Tests nutzbringend eingesetzt werden könnten
- 24. Dezember: Spezielle Immunzellen schützen Ungeborene vor Ansteckung
- 18. Dezember: Dreimal so hohes Sterberisiko durch Covid-19: Bisher grösste Studie zeigt wichtige Unterschiede zu Influenza
- 17. Dezember: Erstmals ein mit Sars-CoV-2 infiziertes Wildtier gefunden
- 15. Dezember: Eine neue Virusvariante breitet sich in England aus
- 14. Dezember: Die Maskenpflicht könnte in Deutschland die Zahl der Neuinfektionen deutlich reduziert haben
- 10. Dezember: Nach AstraZeneca/Oxford publizieren auch Biontech und Pfizer die Ergebnisse ihrer Impfstoffstudie
- 9. Dezember: Baumwollmasken sind Papier überlegen – jedenfalls nach 20-maligem Waschen
- 8. Dezember: Erste wissenschaftliche Publikation zur Wirksamkeit eines Impfstoffs
- 2. Dezember: Wie das Coronavirus ins Gehirn gelangt
- 1. Dezember: Forscher arbeiten an kombinierter Masern-Corona-Impfung
- 24. November: Künstliche Intelligenz «sieht» Covid-19 auf Röntgenbildern
- 24. November: Sars-CoV-2 passt sich in Nerzen an
- 20. November: WHO spricht sich gegen Remdesivir-Behandlung aus
- 16. November: Moderna-Impfstoff soll hohe Wirksamkeit haben
- 16. November: Studie zur Wirkung von Echinaforce gegen Corona relativiert
- 16. November: Johnson & Johnson startet weitere Spätstudie mit Corona-Impfstoff
- 14. November: Ein Inhalationsspray bessert Covid-19-Symptome
- 11. November: Die FDA erteilt Notfallgenehmigung für eine Antikörper-Therapie
- 11. November: Die Massnahmen gegen Covid-19 schützen nur vorübergehend vor anderen respiratorischen Erkrankungen
- 10. November: Kreuzreaktive Antikörper erkennen Sars-CoV-2 und sind häufiger bei Kindern
- 6. November: Sechsmal mehr Kinder infiziert, jede zweite Infektion asymptomatisch
- 5. November: Die Letalität von Covid-19 ist weltweit unterschiedlich, in der Schweiz liegt sie bei 0,75 Prozent
- 4. November: Wer dreckige Luft einatmet, stirbt eher an Covid-19
- 2. November: Der Lockdown hat die Zunahme von Geschlechtskrankheiten nicht gebremst
- 29. Oktober: Eine neue Sars-CoV-2-Variante dominiert Europa
- 28. Oktober: Corona greift auch das Gehirn an
- 27. Oktober: Wie lange verbleiben Antikörper gegen Sars-CoV-2 im Blut?
- 23. Oktober: Körpereigene Hilfe für Sars-CoV-2
- 15. Oktober: Erste Pandemiewelle – in welchem Land gab es wie viele Tote?
- 12. Oktober: Welche Rolle die Übertragung über Aerosole in Büros und Klassenzimmern spielt
- 9. Oktober: Masken senken die Infektionsrate um bis zu 30 Prozent
- 28. September: Fehlgeleitete Antikörper und genetische Defekte als Risikofaktoren
- 24. September: Weniger Grippefälle während der Corona-Pandemie
- 22. September: Das Tragen einer Brille könnte das Risiko einer Infektion mit Sars-CoV-2 senken
- 15. September: Weitere Hinweise darauf, dass Rekonvaleszenten-Plasma den Verlauf von Covid-19 günstig beeinflussen kann
- 9. September: Auch bei jungen Patienten machen starkes Übergewicht und Diabetes einen schweren Krankheitsverlauf wahrscheinlicher
- 8. September: Mit lokalen Strategien lassen sich die Kosten für die Eindämmung des Virus minimieren
- 7. September: Ein Grossteil der von Sars-CoV-2 hervorgerufenen Veränderungen im Lungengewebe ist reversibel
- 3. September: Impfstoffkandidaten auf Basis der ersten bekannten Sars-CoV-2-Genome dürften alle jetzt kursierenden Covid-19-Erreger abdecken
- 30. August: Blutverdünnung kann das Sterberisiko bei hospitalisierten Covid-19-Patienten offenbar erheblich senken
- 26. August: Unterschiede in der Immunantwort zwischen Männern und Frauen
- 25. August: Erstmals bestätigen Forscher eine Zweitinfektion mit dem Coronavirus
- 24. August: Die Suche nach dem Zwischenwirt – Marderhunde sind für Sars-CoV-2 empfänglich
- 20. August: 3 von 1000 infizierten Personen im mittleren Alter sterben an Covid-19 – Forscher präsentieren altersabhängige Todesfallraten
- 18. August: Offenbar wenig Einfluss der Schulöffnung in Norwegen auf die Reproduktionszahl
- 14. August: Ein mathematisches Modell erklärt die unterschiedlichen Ausbreitungsmuster von Grippeviren und Sars-CoV-2
- 13. August: Forscher weisen lebensfähige Viruspartikel in winzigen Schwebeteilchen nach
- 10. August: Ein einfacher Test von Schutzmasken mit Smartphone und Laserlicht
- 3. August: Hunde und Katzen können mit Sars-CoV-2 angesteckt werden – bei Schweinen, Hühnern und anderen Nutztieren gibt es keine Hinweise darauf.
- 29. Juli: Herdenimmunität in Mumbai? In drei Slums haben fast 60 Prozent der Bewohner Antikörper gegen Sars-CoV-2
- 29. Juli: Beatmete Covid-19-Patienten haben ein besonders hohes Risiko zu sterben
- 27. Juli: Die einschränkenden Massnahmen haben viele Menschenleben gerettet, wie eine Modellrechnung zeigt
- 24. Juli: Der Superspreader des Corona-Ausbruchs in der Schlachterei Tönnies ist identifiziert
- 22. Juli: Welche Covid-19-Patienten von Cortisonpräparaten profitieren – und wem die Mittel schaden
- 21. Juli: Mehrere Impfstoffe nehmen eine weitere Hürde
- 20. Juli: Gurgeln statt Rachenabstrich und ein umfunktionierter Blutgruppentest – Alternativen zu gängigen Corona-Tests
- 17. Juli: In Wuhan haben unentdeckte Infizierte vermutlich massgeblich zur Ausbreitung von Covid-19 beigetragen
- 16. Juli: Sars-CoV-2 kann das Gehirn direkt und indirekt schädigen
- 15. Juli: Geschmuggelte Schuppentiere tragen ein Sars-CoV-2-ähnliches Virus – und entwickeln eine Atemwegserkrankung
- 14. Juli: Übertragung von Sars-CoV-2 in der Gebärmutter
- 13. Juli: Die Medikamente Hydroxychloroquin und Lopinavir gelangen nicht in ausreichender Konzentration in die Lunge
- 10. Juli: Wissenschafter fordern ein Frühwarnsystem für Zoonosen
- 9. Juli: Alt, männlich, krank, arm, nicht weiss: Das sind die wichtigsten Risikofaktoren für einen fatalen Covid-19-Verlauf
- 8. Juli: Experte fordert, schwangere Frauen als Risikogruppe einzustufen
- 8. Juli: Das Immungedächtnis könnte doch besser sein als angenommen
- 6. Juli: Neandertaler-Gene könnten das Risiko eines schweren Covid-Verlaufs erhöhen
- 2. Juli: Die Lunge von Covid-19-Patienten durchläuft zwei Stadien
- 29. Juni: War das neue Coronavirus schon im März 2019 in Barcelona?
- 30. Juni: Das HIV-Mittel Lopinavir-Ritonavir ist bei Covid-19 nutzlos
- 25. Juni: Covid-19 im globalen Süden: Jung, aber häufig vorerkrankt
- 23. Juni: Machen Mutationen das Coronavirus gefährlicher?
- 22. Juni: Wann kommt die befürchtete «zweite Welle»?
- 19. Juni: Abwasser als Frühwarnsystem für Sars-CoV-2
- 17. Juni: Wie anfällig sind Kinder?
- 16. Juni: Ein altbekanntes Medikament weckt neue Hoffnungen
- 15. Juni: Nur 11 Prozent der Genfer haben sich infiziert
- 12. Juni: Viele haben im Lockdown mehr, aber schlechter geschlafen
- 10. Juni: Traten die ersten Covid-19-Fälle schon im Herbst in Wuhan auf?
- 9. Juni: Weitere Hinweise für die Wirksamkeit von Remdesivir
- 8. Juni: Schützt die Tuberkulose-Impfung vor Covid-19?
- 5. Juni: Zwei prominente Studien zurückgezogen
- 4. Juni: Strategien zur Reduktion von Kontakten
- 3. Juni: Reproduktionsrate in der Schweiz
- 2. Juni: Das Virus befällt zuerst die Nase
- 1. Juni: Maske, Abstand und Visier – was nützt?
22. Juli: Impfungen mit Pfizer und AstraZeneca sind auch gegen Delta-Variante hochwirksam
ina. · Eine britische Studie bestätigt: Zwei Dosen des Impfstoffs Biontech/Pfizer oder AstraZeneca sind gegen die leichter übertragbare Delta-Variante fast genauso wirksam wie gegen die bisher dominante Alpha-Variante. Beide Impfstoffe verhindern eine symptomatische Erkrankung nach einer Infektion mit der Delta-Variante. Die Wirksamkeit der beiden Impfstoffe sinkt jedoch erheblich bei Personen, die nur eine Dosis erhalten haben.
Laut der Studie, die im «New England Journal of Medicine» publiziert wurde, ist der Pfizer-Impfstoff zu 88 Prozent gegen die Delta-Variante wirksam. Bei der Alpha-Variante betrage die Wirksamkeit 93,7 Prozent. Eine doppelte AstraZeneca-Impfung schütze wiederum zu 67 Prozent gegen die Delta-Variante und zu 74,5 Prozent gegen die Alpha-Variante.
Die Wirksamkeit der Impfstoffe sei jedoch bei Personen, die nur eine Einzeldosis eines der beiden Impfstoffe erhalten hätten, deutlich geringer: Die Studie der britischen Gesundheitsbehörde ergab, dass beide Impfstoffe nur zwischen 30 und 36 Prozent gegen Delta wirksam waren. Die Autoren der Studie analysierten dafür den Impfstatus, PCR-Tests und gemeldete Symptome von 19 000 Jugendlichen und Erwachsenen in ganz Grossbritannien.
Der Biontech/Pfizer-Impfstoff basiert wie auch der Moderna-Impfstoff auf einer mRNA-Technologie. Der Vektorimpfstoff von AstraZeneca
ist in der Schweiz noch nicht zugelassen.
28. Juni: Wie stark beeinflussen die Jahreszeiten die Ausbreitung des Coronavirus?
rtz. · Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie versuchen Wissenschafter, den Einfluss der Jahreszeiten auf die Verbreitung des Virus zu quantifizieren. Diesen zu kennen, wäre wichtig und hilfreich, damit man inmitten der Pandemie mit geeigneten Modellrechnungen ein Stück vorausplanen und Schutzmassnahmen wie das Abstandhalten, das obligatorische Tragen von Masken oder die Schliessung von Schulen und Restaurants dosiert einsetzen könnte.
Allerdings kamen in der Vergangenheit verschiedene Forscherteams zu unterschiedlichen Schlüssen. Mal wurde der Einfluss der Saisonalität auf das Virus als gering, mal als durchaus wesentlich eingeschätzt.
Das liegt vornehmlich daran, dass der Einfluss der Jahreszeiten auf das Infektionsgeschehen komplex und vielgestaltig ist. Darin überlagern sich mehrere, zum Teil in entgegengesetzter Richtung wirkende Effekte. Beispielsweise wirken sich Temperatur, Luftfeuchtigkeit und UV-Strahlung auf die Lebensdauer des Virus in einem Aerosoltröpfchen aus. Gleichzeitig schwankt im Rhythmus der Jahreszeiten aber auch die Fähigkeit des menschlichen Immunsystems, mit Erregern fertigzuwerden. Kommt hinzu, dass sich das Leben in den warmen Monaten nach draussen verlagert, während man die kalten Jahreszeiten lieber mit Beschäftigungen drinnen verbringt. Und dann können noch kulturelle Aspekte wie grosse Feste, Schulferien und Reisetätigkeit der Verbreitung des Virus Vorschub leisten – oder sie eben hemmen.
Angesichts dieser Gemengelage entschied eine interdisziplinäre Gruppe Forschender aus England, den Gesamteinfluss der Jahreszeiten auf die Corona-Pandemie zu untersuchen, anstatt die Effekte einzelner Einflussfaktoren wie Witterung, Schule und Ferien auseinanderzudividieren. Ihre Resultate haben die Forscher unlängst auf medRxiv aufgeschaltet – die Studie ist also noch nicht begutachtet worden.
Die Wissenschafter nahmen an, dass die Jahreszeiten dem Infektionsgeschehen eine sinusförmige Schwankung aufprägen. Ausserdem beschränkten sie ihre Analyse auf Europa, um starke Abweichungen, was die kulturellen und sozialen Einflussfaktoren angeht, auszuklammern. So konnten sie unter Berücksichtigung der in europäischen Ländern beobachteten Fallzahlen und der nichtpharmazeutischen Interventionen den Einfluss der Jahreszeiten auf die Pandemie modellieren.
Sie kamen zu dem Ergebnis, dass der Reproduktionsfaktor R des Coronavirus allein durch saisonale Effekte im Sommer um mehr als 40 Prozent sinkt. Das ist viel – vergleichbar etwa mit den Auswirkungen einer starken einschränkenden Schutzmassnahme wie dem Schliessen von Schulen und Universitäten. Allerdings, so betonen die Autoren, bedeute das Ergebnis nicht, dass im Sommer oder in heissen, feuchten Regionen nicht mit Ausbrüchen zu rechnen sei. Auch unter sommerlichen Bedingungen könne die Reproduktionsrate des Coronavirus über 1 liegen und einen exponentiellen Anstieg der Fallzahlen nach sich ziehen.
10. Juni: AstraZeneca-Impfstoff mit leicht erhöhtem Risiko von Blutungsstörungen
ni. · Der Impfstoff des britischen Herstellers AstraZeneca stand von Anfang an unter einem schlechten Stern. Die negativen Schlagzeilen betrafen zuerst die gegenüber den RNA-Vakzinen geringere Wirksamkeit. Später kamen sehr seltene Fälle von Hirnvenenthrombosen dazu, weshalb einige Länder die Immunisierung mit diesem Impfstoff zeitweise sistierten. Nun berichten britische Wissenschafter über gewisse Blutungsstörungen, die bei diesem Impfstoff häufiger auftreten als etwa bei dem in der Schweiz eingesetzten RNA-Impfstoff von Pfizer/Biontech.
Diese zwei Impfstoffe haben Aziz Sheikh von der Universität Edinburg und seine Kollegen in einer Analyse mit Daten aus Schottland miteinander verglichen. In dem Land haben bis April 2021 mehr als 2,5 Millionen Erwachsene oder 57 Prozent der erwachsenen Bevölkerung die erste Dosis von einer der beiden Vakzine erhalten. Wie die Wissenschafter in der Fachzeitschrift «Nature Medicine» schreiben, zeigten die eingegangenen Meldungen über vermutete Nebenwirkungen für den AstraZeneca-Impfstoff ein leicht erhöhtes Risiko einer Blutungsstörung namens Immune Thrombozytopenische Purpura (ITP). Die schwierig zu diagnostizierende Krankheit verursacht bei einigen Patienten nur blaue Hautflecken, während sie bei anderen lebensgefährliche Blutungen auslöst.
Laut den Forschern trat die Nebenwirkung einer ITP nach der AstraZeneca-Impfung mit einer Frequenz von 1,13 Fällen pro 100 000 Immunisierungen auf. Das ist so selten, dass das Risiko in den Zulassungsstudien mit Zehntausenden von Probanden nicht erkennbar war. Auch bei anderen Blutungskomplikationen und arteriellen Blutgerinnseln fanden die Forscher beim AstraZeneca-Impfstoff minimal erhöhte Werte. Für die Pfizer/Biontech-Vakzine liess sich dagegen in den schottischen Daten kein solches Signal erkennen.
Die Studienautoren betonen, dass das leicht höhere Risiko beim AstraZeneca-Impfstoff im Kontext von dessen klarem Nutzen zu sehen sei. So sei das absolute Risiko einer schweren Impfnebenwirkung deutlich geringer als das Risiko einer schweren oder gar tödlichen Erkrankung nach einer Infektion mit Sars-CoV-2, schreiben sie. Das gelte insbesondere für ältere Personen und solche mit Vorerkrankungen.
2. Juni: Begünstigt die Corona-Impfung bei jungen Männern eine Herzmuskelentzündung?
ni. · Israelische Forscher haben gemäss einem Bericht der Fachzeitschrift «Science» für den Pfizer-Biontech-Impfstoff ein erhöhtes Risiko für eine Herzmuskelentzündung festgestellt. Vor allem junge Männer waren von der auch Myokarditis genannten Krankheit betroffen. Fachleute betonen, dass die in Israel festgestellte statistische Risikoerhöhung Männer nicht von der Immunisierung gegen Covid-19 abhalten sollte. Denn der Nutzen der Impfung überwiege die Risiken.
In einem Bericht an das israelische Gesundheitsministerium schreiben die Forscher laut «Science», dass einer von 3000 bis 6000 Männern im Alter von 16 bis 24 Jahren nach der Impfung eine Entzündung des Herzmuskels entwickelt habe. In den allermeisten Fällen sei die Krankheit mild verlaufen und nach der Gabe von entzündungshemmenden Schmerzmitteln in wenigen Wochen wieder abgeklungen. Bei zwei Männern verlief die Myokarditis tödlich, wobei der Zusammenhang mit der Impfung nicht konklusiv sei.
Auch in den USA und in Europa untersuchen die Gesundheitsbehörden Fälle von Myokarditis, die in einem zeitlichen Zusammenhang mit der Corona-Impfung aufgetreten sind. So hat die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) gemäss «Science» bis Ende Mai 107 Berichte zu Myokarditis-Fällen nach der Pfizer-Biontech-Vakzine erhalten. Das entspreche einem Fall auf 175 000 verabreichte Impfdosen, was deutlich weniger ist als in Israel.
In der Schweiz sind laut Swissmedic bis Ende Mai 12 Fälle von Myokarditis, Perikarditis (Herzbeutelentzündung) und Kombinationen davon gemeldet worden. Vier Meldungen betrafen den Pfizer-Biontech-Impfstoff, sieben die Vakzine von Moderna; bei einer Meldung fehlte die Angabe zum Impfstoff. Die 12 Fälle entsprächen etwa einer Meldung auf 400 000 verabreichte Impfdosen, schreibt Swissmedic.
Bei diesen Melderaten muss berücksichtigt werden, dass in Europa erst sehr wenige Personen unter 30 Jahren geimpft wurden. In Israel indes erhalten seit Ende Januar alle Männer und Frauen über 16 Jahren die Impfung. Gemäss der Agentur Reuters sind in dem Land zwischen Dezember 2020 und Mai 2021 insgesamt 275 Myokarditis-Fälle gezählt worden. Bei rund 5 Millionen geimpften Menschen ist das etwa ein Fall auf 18 000 Geimpfte, was im allgemeinen Hintergrundrauschen der auch ohne Impfung auftretenden Myokarditis-Fälle untergeht. Denn Herzentzündungen können durch verschiedene Viren, auch Sars-CoV-2, wie auch andere Erreger ausgelöst werden.
90 Prozent der festgestellten Myokarditis-Fälle betrafen in Israel jedoch junge Männer unter 30 Jahren. Für diese Altersgruppe – insbesondere jene der 16- bis 19-Jährigen – errechneten die Forscher eine deutlich höhere Fallrate, als sie das ohne die Impfung erwartet hätten. Sie sprechen deshalb von einer «wahrscheinlichen Verbindung» mit der Impfung. Der Hersteller Pfizer indes sagte in einer Stellungnahme, dass bis anhin keine kausale Verbindung zwischen Myokarditis und seiner Impfung etabliert sei.
Was die Gründe für die israelische Beobachtung einer erhöhten Myokarditis-Häufigkeit bei jungen Männern sind, ist noch unklar. Auch noch ungewiss ist, ob die festgestellte Risikoerhöhung nur den in Israel überwiegend eingesetzten Pfizer-Biontech-Impfstoff oder aber auch andere Vakzine betrifft. Spekuliert wird, dass die RNA-Impfung als besonders wirksame Immunisierung bei jungen Männern eine so starke Immunantwort hervorrufen könne, dass daraus in seltenen Fällen eine Herzmuskelentzündung entstehe.
25. Mai: Spürhunde erkennen Virus mit einer Genauigkeit von bis zu 94 Prozent
ina. · Trainierte Hunde können Corona-Infizierte sehr schnell erkennen, selbst solche ohne Symptome, wie neue Versuche der London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) zeigen. Sechs Hunde, die zur Wohltätigkeitsorganisation Medical Detection Dogs gehören, hätten an den getragenen Socken und T-Shirts von 400 Probanden geschnüffelt und infizierte Personen mit hoher Genauigkeit erkannt. Der beste Schnüffler – ein vierjähriger Labrador namens Tala – konnte positive Proben mit einer Genauigkeit von 94 Prozent identifizieren, während der Hund mit der niedrigsten Leistung 82 Prozent erzielte.
Die vorläufigen Studienergebnisse sind zwar nicht so genau wie ein traditioneller PCR-Test, doch um ein Vielfaches schneller, denn Hunde brauchen weniger als eine Sekunde, um Gerüche zu erkennen. Selbst Schnelltests dauern 15 Minuten, und zudem sind sie weniger verlässlich bei asymptomatischen Personen. Hunde, die darauf trainiert sind, das Virus zu erkennen, könnten daher künftig durch Menschenreihen an Flughäfen oder Stadien gehen und die Luft um sie herum erschnuppern. Wenn ein Hund signalisiert, dass jemand mit dem Virus infiziert ist, müsste jedoch ein PCR-Test im Labor durchgeführt werden, um das Ergebnis zu bestätigen. Denn die sechs Hunde hätten 16 von 100 Menschen, die das Virus nicht hatten, fälschlicherweise identifiziert, schreiben die britischen Forscher.
Frühere Studien haben gezeigt, dass der ausgeprägte Geruchssinn von Hunden zur Erkennung von Krebs, Parkinson oder viralen Erkrankungen wie Malaria eingesetzt werden kann. Dabei riechen die Hunde nicht den Erreger an sich. Sie riechen sogenannte flüchtige organische Stoffe (VOC), welche von infizierten Zellen freigegeben und über den Schweiss oder Urin ausgeschieden werden. Hunde riechen und erkennen diese Stoffe – auch kurz nach der Ansteckung, wenn infizierte Personen noch keine Symptome zeigen.
In der nächsten Phase der Studie wollen die britischen Forscher prüfen, ob die Spürhunde das Virus auch an infizierten Personen erkennen – nicht nur an ihren getragenen Socken oder T-Shirts. Auch in der Schweiz, Frankreich oder Libanon werden Corona-Spürhunde ausgebildet, und an Flughäfen in Helsinki und Dubai wurden trainierte Hunde bereits letztes Jahr im Rahmen laufender Versuche eingesetzt.
21. Mai: Leicht erhöhtes Risiko für Babys kurz vor der Geburt
slz. · Schwangere, die sich kurz vor dem errechneten Geburtstermin mit Sars-CoV-2 anstecken, haben ein leicht erhöhtes Risiko, dass die Geburt zu früh einsetzt und das Baby tot auf die Welt kommt. Zu dieser Schlussfolgerung kommt eine Studie, die im «American Journal of Obstetrics and Gynecology» veröffentlicht wurde. In England waren dafür zwischen Ende Mai 2020 und Ende Januar 2021 insgesamt 342 080 Schwangere untersucht worden, 3527 von ihnen hatten eine laborbestätigte Corona-Infektion. Bei dieser Gruppe kam es im Schnitt zu 8,5 Totgeburten pro 1000 Frauen, bei den Nichtinfizierten betrug die Rate 3,4. Schäden bei der sehr grossen Mehrheit der überlebenden Neugeborenen wurden keine festgestellt.
Unklar bleibt, warum die Corona-Infektion eine Gefahr darstellt. Dies könnte an Blutgerinnungsstörungen oder Entzündungen der Plazenta, ausgelöst durch das Virus, oder generell am schlechteren Gesundheitszustand der erkrankten Mutter liegen.
Zudem ist nicht gesagt, dass alle Schwangeren das gleich hohe Risiko für eine Totgeburt aufweisen, wenn sie sich kurz vor dem Geburtstermin infizieren. So wurde nicht angegeben, wie schwer die Erkrankung jeweils verlief. Es kann also sein, dass nur Frauen mit einer schweren Covid-19-Erkrankung das beobachtete erhöhte Risiko für eine Totgeburt aufweisen.
Dessen ungeachtet stelle sich die Frage der Impfung von Schwangeren mit neuer Dringlichkeit, schreiben die Autoren. Zwar lägen noch keine Daten aus klinischen Studien vor, ob die zugelassenen Corona-Impfstoffe für Mutter und Ungeborene sicher seien. Hinweise aus Ländern wie Israel oder den USA, die bereits Schwangere impften, sprächen jedoch dafür.
18. Mai: Forscher schätzen, welche Antikörperkonzentrationen mit Schutz vor Sars-CoV-2-Infektion oder schwerer Erkrankung korrelieren
kus. · Sowohl die zugelassenen Impfungen als auch natürliche Infektionen mit Sars-CoV-2 generieren eine Immunantwort, die vor einer (Re-)Infektion mit dem Virus schützt – zumindest für eine gewisse Zeit. Man geht für die Impfung von mindestens 8 bis 12 Monaten aus, Genesenen empfiehlt man, sich nach etwa 6 Monaten impfen zu lassen. Ein Teil dieser Immunantwort sind die Antikörper, die der Körper spezifisch gegen Sars-CoV-2 herstellt und die das Virus unschädlich machen können, bevor es überhaupt eine Chance hat, eine Infektion zu etablieren. Man weiss, dass diese im Laufe der Zeit abnehmen – aber nicht, bis zu welcher Konzentration sie noch effizient schützen. Das wäre aber wichtig, um beispielsweise Auffrischungsimpfungen sinnvoll planen zu können. Nun haben Forscher hierfür Grenzwerte modelliert und sie in der Fachzeitschrift «Nature Medicine» vorgestellt.
Die Wissenschafter basieren ihr Modell auf Antikörpermessungen bei geimpften und von einer Infektion genesenen Personen und Daten zu deren Risiko, sich trotz Impfung oder durchgemachter Infektion mit Sars-CoV-2 zu infizieren oder schwer zu erkranken. Aufgrund ihrer Berechnungen gehen sie davon aus, dass 20 Prozent der durchschnittlich durch eine natürliche Infektion generierten Antikörper reichen, um das Risiko einer symptomatischen Infektion um 50 Prozent zu reduzieren. Lediglich 3 Prozent der nach natürlicher Infektion durchschnittlich vorhandenen Antikörperkonzentration halbieren demnach das Risiko eines schweren Verlaufs.
In weiteren Schritten versuchten die Forscher aufgrund dieser Berechnungen dann zu simulieren, wie lange die Schutzwirkung anhalten dürfte, wenn das Blut einer Person bestimmte Mengen an Antikörpern enthält. Die Forscher gingen dabei davon aus, dass sich die neutralisierende Antikörpermenge in jeweils gut 100 Tagen halbiert. Demnach dürfte eine anfangs zu 95 Prozent effektive Vakzine nach 250 Tagen noch immer eine Effektivität von 77 Prozent zeigen.
7. Mai: Ein Biomarker erkennt schwere Covid-19-Verläufe
ni. · Die meisten Personen entwickeln nach einer Infektion mit dem neuen Coronavirus keine oder nur geringfügige Symptome. Einige erkranken allerdings so schwer, dass sie medizinische Intensivpflege benötigen – und teilweise trotzdem sterben. Diese besonders gefährdeten Patienten möglichst früh anhand von sicheren Zeichen zu erkennen, wäre von grossem klinischem Nutzen. Denn damit hätten Spitalärzte eine objektive Grundlage, um bei ihren Patienten mit Covid-19 über die benötigten Therapiemassnahmen und den richtigen Behandlungsort zu entscheiden.
Einer internationalen Forschergruppe unter Zürcher Leitung ist bei der Suche nach einem solchen prädiktiven Biomarker offenbar ein Erfolg gelungen. In Zusammenarbeit mit Wissenschaftern aus Tübingen, Toulouse und Nantes haben der experimentelle Immunologe Burkhard Becher von der Universität Zürich und seine Kollegen zeigen können, dass man anhand der Zahl der sogenannten natürlichen Killer-T-Zellen (NKT-Zellen) im Blut einen schweren Covid-19-Verlauf voraussagen kann. Das gelinge «mit hoher Sicherheit und bereits am Tag der Aufnahme ins Spital», wird Becher in einer Medienmitteilung der Universität Zürich zitiert.
Die natürlichen Killer-T-Zellen sind eine heterogene Untergruppe der weissen Blutzellen, genauer: der T-Zellen. Sie sind bereits sehr früh in der Immunabwehr gegen Viren involviert. Bei Patienten mit schwerem Verlauf konnte Bechers Forschergruppe einen starken Abfall dieser Zellen nachweisen. Solche Patienten entwickeln später typischerweise eine überschiessende Immunantwort auf den Krankheitserreger. Die dabei gebildeten Botenstoffe verursachen eine massive Entzündungsreaktion im Körper, wodurch in der Lunge etwa der Gasaustausch gestört wird.
Ähnliche Krankheitsverläufe wie bei Covid-19 sehen Ärzte aber auch bei Infektionen mit anderen respiratorischen Erregern. Um spezifische Unterschiede erkennen zu können, analysierten die Forscher für ihre Arbeit in der Fachzeitschrift «Immunity» nicht nur die Blutproben von 57 unterschiedlich schwer erkrankten Covid-19-Patienten, sondern auch jene von 25 Patienten mit schweren, aber nicht durch Sars-CoV-2 verursachten Lungenentzündungen und von 21 gesunden Kontrollpersonen.
Für die Messung der Immunzellen und Botenstoffe in den Blutproben benützten die Wissenschafter die sogenannte hochdimensionale Zytometrie. Damit können Eiweisse auf der Oberfläche und im Innern von Millionen von Zellen gleichzeitig bestimmt und die Daten anschliessend durch Computerhilfe ausgewertet werden. Wie sich zeigte, war die generelle Immunantwort bei den verschiedenen Formen von Lungenentzündungen sehr ähnlich. Doch bei Patienten mit schwerem Covid-19-Verlauf verhielten sich laut Becher die natürlichen Killer-T-Zellen einzigartig. Diese Zellen würden eine spezifische Immunsignatur definieren, die im Spital nachgewiesen werden könne, so Becher.
3. Mai: Wissenschafter identifizieren einen Antikörper, der gegen alle bisher bekannten Mutationen von Sars-CoV-2 effektiv ist
kus. · Antikörper funktionieren nach dem Schlüssel-Schlüsselloch-Prinzip: Sie erkennen bestimmte Stellen an einem Erreger und docken daran an, was den Erreger blockieren und an der Infektion einer Zelle hindern kann. Voraussetzung ist, dass der Schlüssel ins Schlüsselloch passt. Das ist bei gewissen Antikörpern, die durch eine vorhergegangene Infektion mit älteren Viren oder durch die zurzeit verabreichten Impfungen generiert worden sind, für einige der kursierenden Varianten von Sars-CoV-2 nicht mehr der Fall. Sie tragen Mutationen, die «Schlüssellöcher» am Virus so verändern, dass die auf diese Stellen zielenden Antikörper sie nicht mehr effizient erkennen.
Andere Antikörper, die an nicht veränderte Stellen des Virus andocken, behalten ihre Wirkung dagegen. Nun haben Forscher in einem Experiment mit Mäusen einen solchen Antikörper identifiziert und in einer noch nicht von Fachleuten begutachteten Publikation auf BioRxiv vorgestellt.
Er interagiert mit einer Region auf dem Spike-Protein von Sars-CoV-2, die über alle bekannten Varianten hinweg bis anhin sehr einheitlich geblieben ist, wie die Forscher schreiben – es handelt sich offenbar um eine sogenannte konservierte Region. Zwar fanden sie Mutationen, die den Antikörper wirkungslos werden lassen, diese sind laut dem Bericht aber nur selten und in keiner der bisher als bedenklich angesehenen Linien aufgetreten.
In Versuchen mit Mäusen schützte der Antikörper die Tiere sowohl vor einer Infektion mit einer älteren Linie von Sars-CoV-2 als auch vor einer solchen mit einem Virus, das das Spike-Protein der südafrikanischen Variante B.1.351 besass. Laut den Forschern könnte die konservierte Stelle, mit der der Antikörper interagiert, ein geeignetes Ziel für Antikörper-basierte Medikamente sein.
1. April: Pfizer/Biontech-Impfstoff soll auch bei 12- bis 15-Jährigen gut wirksam sein
ni. · Der auch in der Schweiz eingesetzte Impfstoff von Pfizer/Biontech soll auch bei Jugendlichen zwischen 12 und 15 Jahren eine gute Schutzwirkung entfalten. Das hat Pfizer am Mittwoch auf seiner Website bekanntgegeben. Die Wirksamkeit und Verträglichkeit der Vakzine ist demnach in einer klinischen Studie mit 2260 Adoleszenten untersucht worden. Dabei sind gemäss Pfizer 18 Fälle von symptomatischen Infektionen mit Sars-CoV-2 nachgewiesen worden – alle bei Jugendlichen, die eine Placebo-Impfung erhalten hatten. Ernsthafte Nebenwirkungen seien bisher nicht festgestellt worden. Um später auftretende Probleme erkennen zu können, würden die Jugendlichen aber während zwei Jahren beobachtet.
Die Resultate der Studie sind noch nicht von unabhängiger Seite begutachtet worden. Eine Publikation soll aber laut Pfizer folgen. Das Unternehmen hofft zudem, noch vor Beginn des nächsten Schuljahres die Vakzine für Jugendliche zugelassen zu bekommen. Gleichzeitig ist Pfizer daran, den Impfstoff auch bei Kindern unter 12 Jahren zu testen. Dies soll mit mehreren Studien geschehen, in die Kinder von 6 Monaten bis zu 11 Jahren eingeschlossen werden. Eine Zulassung für Kinder unter 12 Jahren peilt Pfizer für nächstes Jahr an.
Vergleichbare Pläne verfolgt offenbar Moderna, die den zweiten in der Schweiz zugelassenen Impfstoff produziert. Studienresultate für die Altersgruppe der 12- bis 17-Jährigen sollen laut dem Unternehmen in den nächsten Wochen und solche für Kinder zwischen 6 Monaten und 12 Jahren in der zweiten Hälfte des Jahres präsentiert werden.
Noch ist allerdings unklar, wie wichtig es überhaupt sein wird, neben den Erwachsenen auch Kinder gegen Covid-19 zu impfen. Wie in der Schweiz sieht die Impfstrategie in vielen Ländern vorerst nur die Immunisierung der besonders gefährdeten Personen, des Gesundheitspersonals und aller Erwachsenen, die das wünschen, vor. Dies dürfte laut Experten auch genügen, um der Pandemie ihren unmittelbaren Schrecken zu nehmen. Soll danach die Zirkulation des Virus weiter reduziert werden, könnte die Impfung von Kindern und Jugendlichen ein Thema werden. Zudem können sich Eltern bei ihrem Kind aufgrund des individuellen Nutzen-Risiko-Verhältnisses für die Impfung entscheiden.
25. März: Die Corona-Impfung ist vor einer Operation besonders sinnvoll
ni. · Nach welchen Kriterien sollte die Impfpriorisierung in Pandemiezeiten vorgenommen werden? Dieser Frage ist ein internationales Forscherteam aus 116 Ländern nachgegangen – und seine Antwort könnte der Diskussion einen neuen Impuls geben. Für die im «British Journal of Surgery» veröffentlichte Arbeit sammelten die Wissenschafter im vergangenen Oktober in weltweit 1667 Spitälern die Daten von mehr als 140 000 Patienten, die gerade vor einer nicht notfallmässigen Operation standen. Dann schauten sie, wie viele der Patienten innerhalb von vier Wochen nach dem Eingriff an Covid-19 erkrankten und starben. Diese Daten verglichen sie mit den Covid-19-Infektions- und -Todesfallraten in der Allgemeinbevölkerung.
Die Studie sei die grösste wissenschaftliche Zusammenarbeit aller Zeiten, schreibt das Kantonsspital Winterthur in einer Pressemitteilung. Allein in der Schweiz hätten 54 Ärzte aus 9 Spitälern Daten von 555 Patienten aus allen operativen Disziplinen geliefert. Den Schweizer Beitrag koordinierte der Chirurg Michel Adamina vom Kantonsspital Winterthur.
Wie die mathematische Modellierung der Daten zeigt, erkrankten in den Spitälern 0,6 bis 1,6 Prozent der Patienten nach der Operation an Covid-19. Bei diesen Personen war das Risiko zu sterben bis zu achtmal höher als bei operierten Patienten ohne Covid-19. Besonders stark erhöhte die Infektionskrankheit das Sterberisiko bei über 70-jährigen Krebspatienten, die sich unters Messer legen mussten: von 2,8 Prozent (ohne Covid-19) auf 18,6 Prozent (mit Covid-19).
Als Nächstes modellierten die Forscher den potenziellen Nutzen, den die Corona-Impfung bei den Patienten vor dem Wahleingriff hat. Die Resultate verglichen sie mit dem Effekt, den die Immunisierung in der Allgemeinbevölkerung entfaltet. Bei den erwähnten Krebspatienten über 70 Jahre müssten gemäss der Studie 351 Personen geimpft werden, um ein Leben zu retten. Weil dieser Wert von sehr vielen Faktoren abhängt, wie etwa von der in einer Region herrschenden Infektionsrate, könnte die erhoffte Impfwirkung auch schon bei 196 geimpften Personen (bester Fall) oder aber erst bei 816 Geimpften auftreten (schlechtester Fall).
Bei den über 70-jährigen Patienten ohne Krebs, die sich ebenfalls einer Operation unterziehen müssen, ist der berechnete Nutzen der Impfung laut den Forschern mit durchschnittlich 733 notwendigen Impfungen für einen verhinderten Todesfall bereits deutlich geringer. Noch viel kleiner ist er allerdings bei den über 70-Jährigen in der Allgemeinbevölkerung. Hier müssen für die Verhinderung eines Todesfalls im Durchschnitt 1840 Personen geimpft werden. Das sind auch deutlich mehr Impfungen, als bei jüngeren Krebspatienten (559) und jüngeren Patienten ohne Krebs (1621) notwendig sind, falls diese vor einer Operation stehen.
Laut dem Schweizer Vertreter der Studie, Michel Adamina, sprechen die Ergebnisse dafür, dass chirurgische Patienten jenseits der bisherigen Priorisierungsgruppen geimpft werden sollten. Mit der geforderten Anpassung der Impfpolitik liessen sich – auch das haben die Forscher berechnet – in einem Jahr weltweit durchschnittlich 58 687 durch Covid-19 bedingte Todesfälle verhindern. Zudem könnte das vermehrte Impfen vor Operationen dazu beitragen, dass in den Spitälern nicht mehr so viele Wahleingriffe verschoben werden müssen, wie das in der ersten Pandemiewelle nötig war. Damals wurden bis zu 70 Prozent der Eingriffe oder weltweit 28 Millionen Operationen verschoben oder abgesagt.
23. März: Britische Forscher identifizieren erste rekombinante Sars-CoV-2
kus. · Wieder einmal hat sich ausgezahlt, dass in Grossbritannien die dort zirkulierenden Sars-CoV-2 intensiv genetisch überwacht werden: Britische Wissenschafter konnten die ersten Fälle dokumentieren, in denen sich zwei verschiedene Linien von Sars-CoV-2 zu einer neuen Virusvariante vermischt haben, wie sie in einer noch nicht von Experten begutachteten Publikation auf virological.org schreiben.
Dies kann geschehen, wenn eine Person gleichzeitig mit zwei verschiedenen Viruslinien infiziert ist. Wenn sich beide in derselben Zelle vermehren, kann es passieren, dass beim Zusammenbau der neu entstehenden «Nachkommen-Viren» genetische Bruchstücke von beiden «Eltern-Linien» zufällig in einem einzigen Virus vereinigt werden. Das Rekombination genannte Phänomen ist von Coronaviren bekannt, aber auch bei Grippeviren sehr wichtig. Es war daher zu erwarten, dass es zur Entstehung von rekombinanten Sars-CoV-2 kommen würde.
Die nun identifizierten sogenannten rekombinanten Viren dürften laut den Forschern zwischen Oktober 2020 und Januar 2021 entstanden sein, als Sars-CoV-2 in Grossbritannien weit verbreitet war. Damals nahm die neue Linie B.1.1.7 rasant zu und verdrängte die vorher kursierenden Viren zunehmend. Entsprechend ist auch bei allen der nun identifizierten Rekombinanten einer der «Elternteile» ein B.1.1.7-Virus.
Insgesamt identifizierten die Forscher acht verschiedene Rekombinanten, sechs davon besassen das Spike-Protein der B.1.1.7-Linie. Auf den Verlauf der Pandemie hat die Entdeckung laut den Forschern keine sofortigen Auswirkungen. Wie auch bei Mutationen dürften die weitaus meisten Rekombinations-Ereignisse keine Auswirkungen auf die Ausprägung des Virus haben.
16. März: Höheres Sterberisiko bei einer Infektion mit der britischen Variante von Sars-CoV-2
kus. · Laut einer in der wissenschaftlichen Fachzeitschrift «Nature» publizierten Untersuchung aus Grossbritannien haben Personen, die sich mit einem Virus aus der Linie B.1.1.7 des neuen Coronavirus angesteckt haben, ein erhöhtes Risiko, an der Infektion zu sterben. Im Vergleich zu einer Infektion mit einem «gewöhnlichen» Sars-CoV-2 ist es um 55 Prozent höher, wie die Forscher schreiben. Das bedeute, dass etwa das Risiko eines 55–69 Jahre alten Mannes, in den 28 Tagen nach einem positiven Coronatest zu sterben, von 0,6 auf 0,9 Prozent steige.
Die Wissenschafter basierten ihre Studie auf Daten von weit über zwei Millionen positiven Corona-Tests. Sie analysierten dabei unter anderem, wie hoch der Anteil der neuen Variante an den positiven Tests war, wie dieser sich über die Zeit änderte und wie viele Personen in den 28 Tagen nach einem positiven Test starben. Zum Vergleich dienten Daten aus der Zeit vor der Ausbreitung der neuen Variante; die Forscher beachteten dabei unter anderem auch die Belegung der Hospitäler und das Geschlecht der Betroffenen.
Bereits Ende Januar hatten die Experten der britischen New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group (Nervtag) aus der Auswertung mehrerer Studien geschlossen, dass eine Infektion mit einem Virus aus dieser Linie mit einem höheren Hospitalisations- und Sterberisiko einhergehe.
9. März: Mehr Coronavirus-Infektionen bei stärkerem Pollenflug
(dpa)/lsl. · Starker Pollenflug kann laut einer Studie das Risiko für eine Sars-CoV-2-Infektion erhöhen. Gebe es viele Pollen in der Aussenluft, stiegen die Infektionszahlen, berichtet ein Forschungsteam in der Wissenschaftszeitschrift «Proceedings of the National Academy of Sciences» («PNAS»).
Pro 100 Pollenkörner in einem Kubikmeter Luft stiegen die Infektionsraten an Orten ohne Lockdown-Regelungen – und demnach ohne Einschränkung der Übertragung – im Schnitt um jeweils 4 Prozent. In manchen deutschen Städten seien im Untersuchungszeitraum zeitweise pro Tag bis zu 500 Pollen auf einen Kubikmeter gekommen – dabei stiegen die Infektionsraten um mehr als 20 Prozent.
Die Forscher erklären das Phänomen folgendermassen: Wenn Pollen flögen, reagiere die Körperabwehr in abgeschwächter Form auf Viren der Atemwege, die Schnupfen und Erkältungen verursachen – und das unabhängig vom allergenen Potenzial der Pollen. Der Körper produziere dann unter anderem weniger sogenannte antivirale Interferone. Diese Botenstoffe rufen benachbarte Zellen dazu auf, ihre antivirale Abwehr zu verstärken, um die Eindringlinge in Schach zu halten.
Die täglichen Infektionsraten korrelierten mit der Pollenzahl in Ländern mit und ohne Lockdown. Bei vergleichbarer Pollenkonzentration in der Luft war die Zahl der täglichen Infektionen im Schnitt halb so hoch mit Lockdown als ohne. Zusammen mit der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur könne der Pollenflug 44 Prozent der Varianz der Infektionszahlen erklären, schreiben die Forscher.
Die Autoren hatten Daten zur Pollenbelastung und Sars-CoV-2-Infektionsraten aus 130 Stationen in 31 Ländern auf fünf Kontinenten analysiert. Sie berücksichtigten auch demografische Faktoren und Umweltbedingungen, darunter die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit, die Bevölkerungsdichte und die Ausprägung des Lockdowns.
Laut einer Pressemitteilung rät die leitende Forscherin Claudia Traidl-Hoffmann Personen aus der Risikogruppe, die Pollenflugprognosen in den nächsten Monaten zu Rate zu ziehen. Sie könnten Masken tragen, wenn die Pollenkonzentration hoch sei. Das könne das Virus und den Pollen gleichermassen von den Atemwegen fernhalten.
3. März: Viele Covid-19-Patienten entwickeln ein Post-Covid-Syndrom
lsl. · Über Patienten, die sich nach einer Covid-19-Erkrankung lange nicht erholen, wurde schon viel berichtet. Die Rede ist in diesem Zusammenhang meist von Long Covid. Unter Forschern hat sich nun ein neuer Begriff etabliert: das Post-Covid-Syndrom. Doch wie häufig und wie schwer die anhaltenden Symptome sind, ist bis heute schwer zu sagen.
Eine Forschungsgruppe um Milo Puhan von der Universität Zürich versucht, dies mit einer laufenden Studie im Kanton Zürich zu klären. Kürzlich veröffentlichten sie Zwischenergebnisse in einer Preprint-Publikation. Demnach fühlt sich jeder vierte Sars-CoV-2-Infizierte sechs bis acht Monate nach der Infektion immer noch nicht vollständig erholt. Das ist weit mehr als in einer britischen Studie, in der nach 12 Wochen nur noch 2 Prozent der Befragten über Symptome berichtete. In anderen Studien, in denen nur schwer erkrankte Covid-19 Patienten befragt wurden, waren anhaltende Symptome dagegen noch häufiger.
In der Zürcher Studie hatten gut die Hälfte der Teilnehmer eine milde bis mittelschwere Covid-19-Erkrankung durchgemacht. Ein geringer Teil war asymptomatisch, und ein Fünftel wurde aufgrund einer schweren Erkrankung im Spital behandelt.
55 Prozent der Befragten litten nach mehr als sechs Monaten noch unter körperlicher und geistiger Erschöpfung, 25 Prozent unter Atemlosigkeit, und 26 Prozent zeigten depressive Symptome. 40 Prozent der Studienteilnehmer meldeten sich nach der akuten Infektion noch mindestens einmal wegen anhaltender Beschwerden im Zusammenhang mit Covid-19 bei einem Arzt, einige mussten sogar noch einmal hospitalisiert werden. Letztgenanntes betraf 10 Prozent der 81 Patienten, die zu Beginn im Spital behandelt wurden.
Die Forscher hatten mehr als 1300 im Kanton Zürich positiv auf Sars-CoV-2 getestete Personen gebeten, an ihrer Studie teilzunehmen. Knapp 440 Personen waren bereit dazu. Diese füllten mehrere Monate lang regelmässig verschiedene Fragebögen aus, in denen eine Reihe von Symptomen und deren Ausprägung abgefragt wurden.
Unklar bleibt, inwiefern die erfassten Post-Covid-Symptome mit der Covid-19-Erkrankung zusammenhängen. Denn der Zustand der Studienteilnehmer war vor der Erkrankung nicht erfasst worden, und es fehlte auch eine Vergleichsgruppe, die ohne eine Erkrankung dieselben Tests im gleichen Zeitraum regelmässig beantwortete.
Das macht es so schwierig, eine klare Aussage über die Häufigkeit des Post-Covid-Syndroms zu treffen. Das räumen auch die Forscher ein. Unter depressiven Symptomen und Erschöpfung dürften in den letzten Monaten viele Menschen auch ohne eine vorherige Covid-19-Erkrankung gelitten haben. Jedoch ist unbestritten, dass viele der Post-Covid-Betroffenen stark beeinträchtigt sind und Unterstützung brauchen. Das sollte man ernst nehmen, schreiben die Forscher.
26. Februar: Auch in den USA tauchen neue Varianten von Sars-CoV-2 auf
slz. · Die Varianten wurden in New York beziehungsweise in Kalifornien entdeckt. Eine der New Yorker Varianten enthält unter anderem die Mutation E484K. Diese hat man auch in der – seit einigen Wochen für Beunruhigung sorgenden – südafrikanischen sowie der brasilianischen Variante gefunden. E484K ermöglicht es dem Coronavirus, den gegen seine ursprüngliche Form gerichteten Antikörpern teilweise zu entkommen. Das Immunsystem von Geimpften wie Genesenen kann somit Viren mit E484K-Mutation weniger effizient bekämpfen.
Zudem hat man in New York Sars-CoV-2-Varianten entdeckt, die aufgrund einer Veränderung an der Position 501 des Stachelproteins deutlich ansteckender sind. Diese Veränderung kommt unter anderem in der britischen Variante vor. Die Forscher gehen davon aus, dass sich die diversen Varianten in den letzten drei Monaten «alarmierend schnell» ausgebreitet haben. Ein Viertel der New Yorker Corona-Infizierten weise sie auf, auch ausserhalb der Stadt seien sie bereits verbreitet.
Wissenschafterkollegen aus San Francisco haben laut dem Fachmagazin «Science» in Kalifornien Sars-CoV-2-Varianten entdeckt, die schätzungsweise bei jedem fünften Corona-Infizierten vorkommen. Sie enthalten einige nie zuvor beschriebene Mutationen. Die Forscher sind überzeugt, dass diese Varianten ansteckender und resistenter gegen Sars-CoV-2-Antikörper sind als die letzten Sommer zirkulierenden «alten» Virusvarianten. Allerdings beruht diese Einschätzung auf Daten von sehr wenigen Patienten, eine Studie liegt noch nicht vor.
Derzeit sieht es nicht so aus, als ob die in den USA nun entdeckten Varianten gefährlicher sind als die in den vergangenen Wochen in Grossbritannien, Südafrika oder Brasilien aufgetauchten oder gar die verfügbaren Impfungen überhaupt nicht mehr wirken. Es kommt nicht unerwartet, dass gerade in New York neue, unangenehmere Virusvarianten zirkulieren. Dort gab es in der ersten Pandemiewelle sehr viele Infizierte. Daher haben die alten Sars-CoV-2-Varianten weniger Chancen, sich auszubreiten, zufällig entstandene neue Varianten, die ansteckender sind oder dem Immunsystem teilweise entkommen, hingegen grössere. Die Entdeckung neuer Mutationen überall dort, wo man danach sucht, unterstreicht die Bedeutung der genetischen Überwachung des Virus.
24. Februar: Bereits nach einer Dosis Impfstoff sinkt das Risiko einer Hospitalisierung wegen Sars-CoV-2 erheblich
kus. · Forscher aus Grossbritannien haben in Schottland anhand der gesamten Bevölkerung den Effekt einer einzelnen ersten Impfdosis entweder der Pfizer/Biontech- oder der AstraZeneca-Vakzine auf die Zahl der Hospitalisierungen untersucht. Demnach schützt bereits eine Portion Impfstoff in erheblichem Mass davor, wegen einer Sars-CoV-2-Infektion ins Spital zu müssen, wie die Wissenschafter in einer noch nicht von Fachexperten begutachteten Publikation beschreiben, die als Preprint auf «The Lancet» veröffentlicht wurde.
Für die Pfizer/Biontech-Vakzine errechneten die Forscher in der Zeit zwischen 28 und 34 Tagen nach der Impfung eine Wirksamkeit von 85 Prozent gegen eine Spitaleinweisung und für den AstraZeneca-Impfstoff im selben Zeitfenster eine Effektivität von 94 Prozent. Bei einer Wiederholung der Analyse, bei der sie diese auf Personen ab 80 Jahren beschränkten, ergab sich für beide Impfstoffe zusammen immer noch eine Wirksamkeit gegen Hospitalisationen von gut 80 Prozent. Andere Endpunkte – beispielsweise Infektionen, Verläufe oder Todesfälle – wurden nicht untersucht.
In Schottland wurde zuerst mit der Pfizer/Biontech-Vakzine und erst später mit jener von AstraZeneca geimpft; ältere Personen erhielten laut den Forschern eher den letzteren Impfstoff. Dies führte zum einen dazu, dass die Forscher für den ersteren Impfstoff zeigen konnten, dass die Schutzwirkung nach dem 34. Tag wieder etwas nachlässt. Für die AstraZeneca-Vakzine war das wegen des Endpunkts der Studie nicht möglich; auch ist die Wirkung der Impfstoffe deshalb nicht direkt vergleichbar.
Zum anderen könnte die Wirkung des AstraZeneca-Impfstoffs deshalb auch etwas überschätzt worden sein: Dann nämlich, wenn sich nur gesunde Personen impfen lassen und Leute mit Symptomen – die dann kurz darauf ins Spital mussten – in der ungeimpften Probandengruppe verblieben, wie ein Forscher gegenüber dem britischen Science Media Center (SMC) anmerkte. Insgesamt halten die vom SMC befragten Wissenschafter die Resultate der Untersuchung aber trotz deren Limitierungen für sehr vielversprechend.
21. Februar: Die Pfizer/Biontech-Vakzine soll Ansteckungen mit Sars-CoV-2 zu fast 90 Prozent verhindern
kus. · Israel impft im internationalen Vergleich besonders schnell. Ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung ist mit zwei Impfungen bereits voll immunisiert, was Beobachtungsstudien zur Effizienz der Impfung auf Bevölkerungsebene erlaubt. Die Ergebnisse einer solchen Untersuchung sollen nun darauf hindeuten, dass die Pfizer/Biontech-Impfung fast 90 Prozent der Ansteckungen mit Sars-CoV-2 verhindert. Das wäre für die Bekämpfung der Pandemie sehr wertvoll. Das Design der Studie könnte allerdings asymptomatische Fälle bei geimpften Personen unterschätzen.
Die Studie selbst ist bis anhin weder als Preprint veröffentlicht, noch haben sich Pfizer und Biontech dazu geäussert. Verschiedene Medien berichten allerdings über die Ergebnisse, und ein Journalist aus Israel hat offenbar Seiten der Untersuchung auf Twitter veröffentlicht. Durchgeführt wurde sie laut dem von den Herstellern und dem israelischen Gesundheitsministerium. Ausgewertet wurden laut der getwitterten Seiten Daten von Personen, deren zweite Impfung mindestens sieben Tage zurücklag. Die Untersuchung lief etwa drei Wochen von Mitte Januar bis in den Februar.
פרסום ראשון: מחקר של בכירי משרד הבריאות ובכירים בפייזר (אני יודע, תיכף אגיע לזה): החיסון יעיל בכ-90% נגד הדבקה, כ-93% נגד אשפוזים ונגד תמותה. עושה שימוש במידע מותמם ולא אישי של המתחסנים בישראל, וב”מתחסנים” הכוונה היא לשבוע אחרי מנה שנייה. מתייחס לאמצע ינואר עד פבר’. @ynetalerts pic.twitter.com/R1RpdAlCFJ
— נדב איל Nadav Eyal (@Nadav_Eyal) February 18, 2021
Die Analyse beruht auf den Ergebnissen von PCR-Tests, die aus verschiedensten Gründen durchgeführt wurden. Der Impfstatus der Getesteten ist aufgrund von Patientendaten nachvollziehbar. Von den 94 Prozent der positiv getesteten Personen, die nach Symptomen befragt wurden, gaben 60 Prozent an, keine verspürt zu haben.
Allerdings schreiben die Forscher selbst, dass in ihrer Untersuchung asymptomatische Fälle bei voll geimpften Personen unterrepräsentiert sein könnten. Denn diese sind laut den Forschern von der Testpflicht bei der Einreise nach Israel und nach Kontakt mit infizierten Personen ausgenommen. Sollten solche Personen asymptomatisch infiziert sein, fielen sie durch das Beobachtungsnetz – im Gegensatz zu asymptomatischen, aber nicht geimpften Personen, die sich in diesen Situationen verpflichtend testen lassen müssen.
Grundsätzlich schliessen sie aus ihrer Analyse, dass die in den Zulassungsstudien gefundene Wirksamkeit des Impfstoffs auch bei der Impfung in der Bevölkerung bestehen bleibt – obwohl auch Personengruppen wie schwangere Frauen oder Patienten mit unterdrücktem Immunsystem geimpft wurden. Die Impfung verhinderte demnach etwa 93 Prozent der Todesfälle und knapp 94 Prozent der symptomatischen Erkrankungen, und dies, während die vorherrschende Variante die britische Viruslinie B.1.1.7 war.
Vor wenigen Tagen hatte eine in der Fachzeitschrift «The Lancet» veröffentlichte Studie aus Israel ergeben, dass bereits die erste Dosis der Pfizer/Biontech-Vakzine ab 15 Tagen nach der Impfung einen Schutz von etwa 85 Prozent gegen eine symptomatische Infektion vermittelt. Diese Analyse beruht auf Daten von Medizinpersonal. Es handelt sich ebenfalls um eine Beobachtungsstudie, bei der nicht aktiv nach asymptomatischen Fällen gesucht wurde.
19. Februar: Forscher vermuten, dass das Ausmass der Corona-Pandemie in afrikanischen Ländern deutlich unterschätzt wird.
slz. · Afrika ist nach wie vor ein grosses Corona-Rätsel: Das Virus scheint auf seinem Weg von Asien nach Europa und Amerika den Kontinent sozusagen fast überflogen zu haben. Nur in Südafrika wurde bisher ein intensives Infektionsgeschehen mit über 20 000 Toten, mehr als 750 000 Infizierten und nun sogar einer neuen Virusvariante festgestellt, gegen die die bisher zugelassenen Impfstoffe nur noch eingeschränkt wirksam sind. Laut einem Forscherteam aus Sambia und Boston um Lawrence Mwanayanda könnte des Rätsels Lösung so einfach wie beunruhigend sein: Die Sars-CoV-2-Ausbreitung werde in weiten Teilen Afrikas übersehen, weil nur wenig und lückenhaft getestet werde.
Das Team hat nämlich bei knapp 20 Prozent einer kleinen Gruppe an Toten Sars-CoV-2 gefunden. Die 364 Verstorbenen waren zwischen Juni und September letzten Jahres in der Pathologie des University Teaching Hospitals in der Hauptstadt Lusaka untersucht worden. Bei ihnen wurde maximal 48 Stunden nach dem Tod ein Nasenabstrich genommen und mittels PCR-Test untersucht. Die Rate an Corona-Positiven bei den Verstorbenen entspricht in etwa derjenigen in der Schweiz und in Deutschland in den Hochphasen der Pandemie.
Ob die Personen an oder mit dem Virus gestorben sind, ist unklar. Allerdings habe die Mehrheit gemäss den Angaben der Angehörigen Covid-19-typische Symptome aufgewiesen, berichten die Forscher. Mindestens drei Viertel der Sars-CoV-2-positiven Toten seien wahrscheinlich an Covid-19 gestorben, bei den restlichen Fällen sei dies auch möglich, es fehlten jedoch medizinische Angaben zum Zustand der Patienten vor ihrem Tod.
Fast 75 Prozent der Probanden verstarben ausserhalb des Spitals. Keiner von ihnen war je auf Sars-CoV-2 getestet worden. Auch von den im Spital Verstorbenen wurde fast niemand zuvor auf das Coronavirus getestet. Das lasse den Schluss zu, dass Sars-CoV-2 zumindest in Lusaka ähnlich grassiere wie anderswo, aber wegen mangelnder Test- und anderer medizinischer Kapazitäten nicht erkannt werde, betonen die Autoren.
Laut ihnen ist dies die erste systematische Überwachung von Sars-CoV-2 anhand von Labordaten in einem afrikanischen Land jenseits von Südafrika. Zwar handle es sich nur um eine kurze und kleine Studie, die zudem nur in einem Spital von Sambia durchgeführt worden sei. Doch es sei gut möglich, dass die Lage auch in anderen afrikanischen Ländern ähnlich sei, heisst es in der in der Fachzeitschrift «British Medical Journal» erschienenen Publikation.
12. Februar: Wer sich trotz einer ersten Impfung mit Corona infiziert, produziert offenbar weniger Viren – und könnte deshalb weniger ansteckend sein
kus. · Die zugelassenen Impfungen gegen das neue Coronavirus Sars-CoV-2 schützen effizient vor Erkrankungen durch das Virus. Eine wichtige, weiterhin offene Frage aber ist, inwieweit Personen, die sich trotz Impfung anstecken, das Virus an andere weitergeben können. Nun präsentieren Forscher aus Israel hierzu in einer bisher nicht von Fachkollegen begutachteten Publikation auf dem Preprint-Server medRxiv Daten, die auf eine geringere Virenlast bei solchen Personen hindeuten.
Die Wissenschafter um Roy Kishony vom Israel Institute of Technology verglichen die Viruslast von Infizierten, die sich ohne Impfung mit Sars-CoV-2 angesteckt hatten, mit jener von Personen, die in den ersten elf Tagen oder ab dem zwölften Tag nach einer ersten Dosis des Pfizer/Biontech-Impfstoffs positiv getestet worden waren. Insgesamt analysierten sie Daten von knapp 6000 Infizierten. Als Massstab benutzten sie den sogenannten Cycle-threshold-Wert (Ct-Wert). Dieser beschreibt, wie viele PCR-Verdoppelungszyklen es braucht, bis Erbgut sicher nachgewiesen werden kann. Ist viel Erbgut im Ausgangsmaterial vorhanden, braucht es hierfür weniger Zyklen als bei geringen Mengen an Erbgut in den Proben.
Bei ihrer Analyse fanden die Forscher heraus, dass es ab dem zwölften Tag nach der Impfung durchschnittlich zwei Zyklen mehr brauchte, um Erbgut nachzuweisen, als bei Infektionen, zu denen es kürzere Zeit nach der Impfung oder ohne Impfung gekommen war. Das entspreche einer Reduktion der Virenlast bei Infektionen nach Tag zwölf um etwa den Faktor vier, erklärt Clemens Wendtner von der München Klinik Schwabing gegenüber dem deutschen Science Media Center. Das passt laut dem Experten dazu, dass der Schutz durch die Impfung nach etwa zwölf Tagen einsetzt. Laut den Autoren könnte ihr Resultat darauf hindeuten, dass Personen, die sich nach Tag zwölf infizieren, weniger ansteckend sind.
Allerdings hat die Studie einige Einschränkungen: So bleibt laut Marco Binder vom Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg fraglich, inwieweit sich eine vierfache Verringerung in Anbetracht der typischerweise nachgewiesenen RNA-Mengen im Bereich von Hunderttausenden oder Millionen von RNA-Molekülen tatsächlich auf die Infektiosität auswirkt. Auch spielen hierfür die Viren aus dem Rachen eine grössere Rolle als jene aus der Nase – in der Studie wurden jedoch Proben aus Nasen-Rachen-Abstrichen untersucht, worauf auch die Autoren hinweisen. Ebenfalls unklar ist, wie sich der gemessene Effekt über die Zeit entwickelt. Zudem wird die verwendete Methode als für diesen Zweck zu ungenau kritisiert.
11. Februar: Aerosol-«Superspreader» – das Alter und das Gewicht sind ausschlaggebend
lsl. · Vor der Pandemie machte sich kaum einer über ausgeatmete Aerosole Gedanken. Aber mittlerweile wissen wir: Mit diesen Tröpfchen werden Viren ausgestossen, und je mehr davon eine infizierte Person abgibt, desto ansteckender ist sie wahrscheinlich. Nun haben Forscher analysiert, wie gross die Unterschiede in der Aerosolbildung bei gesunden Personen sind.
Bei 194 Studienteilnehmern detektierten sie die Aerosole im Atem, während jene Atemmasken trugen. Der Unterschied war gross. Einige wenige Probanden atmeten sehr viele Partikel aus: 18 Prozent von ihnen produzierten 80 Prozent der winzigen Tröpfchen, wie die Forscher berechneten. Das Verhältnis der Aerosol-«Superspreader» passe gut zu dem beobachteten Verhältnis der Viren-Superspreader von ebenfalls etwa 20:80, schreiben sie in der Zeitschrift «PNAS».
Die Aerosole entstehen laut den Forschern, wenn die Atemluft mit hoher Geschwindigkeit über die mit flüssigem Schleim überzogenen Atemwege streicht. Deshalb entstehen beim Lachen, Singen oder lauten Reden auch mehr Aerosole. Dabei kommt mehr Bewegung in die Flüssigkeit, sie wird aufgepeitscht, ähnlich wie wenn Wind über das Meer fegt und feine Tröpfchen aufwirbelt.
Faktoren wie etwa die Ernährung und das Alter beeinflussten die Beschaffenheit des Schleims – und damit wahrscheinlich auch die Aerosolbildung, schreiben die Forscher. Sie suchten deshalb nach Zusammenhängen. Keinen Unterschied gab es zwischen Männern und Frauen. Jedoch scheint das Alter und Gewicht der Personen einen Unterschied zu machen. So gehörten junge Menschen mit einem tiefen Body-Mass-Index nicht zur Gruppe der Aerosol-«Superspreader», jedoch auffallend viele Übergewichtige mit höherem Alter.
Wichtiger aber noch: Die Aerosolbildung scheint bei einer Sars-CoV-2-Infektion zuzunehmen. Das hatten die Forscher in einer früheren Arbeit bei einem einzelnen Patienten beobachtet. Um nun genauer zu untersuchen, wie sich die Menge der ausgestossenen Aerosole im Laufe einer Infektion entwickelt, infizierten sie acht Affen mit Sars-CoV-2.
Täglich analysierten sie dann die Menge der Viren im Nasensekret sowie die abgegebenen Aerosole. Mit steigender Viruslast nahm die Zahl der Tröpfchen im Atem stetig zu, bis sie an Tag 7 einen Spitzenwert erreichte. Danach sank sie wieder ab. Die Forscher nehmen an, dass während einer Sars-CoV-2-Infektion auch bei Menschen die Menge der Aerosole zunimmt und das in jeder Altersgruppe.
10. Februar: Das Thromboserisiko bleibt bei Covid-19 zwei Monate lang erhöht
ni. · Dass eine Infektion mit dem neuen Coronavirus das Risiko für Blutgerinnsel in den Venen und – etwas weniger stark – in den Arterien erhöht, haben Ärzte schon in der ersten Welle der Pandemie festgestellt. Die Verklumpungen können sich bei den Patienten als Venenthrombose, Lungenembolie, Herzinfarkt oder Hirnschlag äussern. Wegen dieser Gefahr erhalten seit längerem alle hospitalisierten Covid-19-Patienten eine medikamentöse Thromboseprophylaxe mit Heparin oder einem anderen Medikament. Ob auch die – weniger schwer erkrankten – ambulanten Patienten von einer solchen Prophylaxe profitieren, ist weniger klar.
Diese Frage kann zwar auch eine neue Studie aus Schottland nicht beantworten. Die Arbeit zeigt aber, dass das Risiko für Thromboembolien (unter diesem Begriff werden die durch Blutgerinnsel bedingten Krankheiten zusammengefasst) bis zu zwei Monate nach der laborbestätigten Covid-19-Diagnose anhält – und das auch bei jüngeren und ambulanten Patienten. Für ihre auf dem Preprint-Server medRxiv erschienene Untersuchung hat die Gruppe von Frederick Ho von der Universität Glasgow fünf nationale Gesundheitsdatenbanken angezapft. Damit konnten sie in dem Land mit 5,5 Millionen Einwohnern alle Personen mit einer erfassten Covid-19- und Thromboembolie-Diagnose identifizieren.
Bis Anfang Oktober liessen sich knapp 1500 Patienten mit einer solchen Doppeldiagnose finden (bei gut 30 000 Covid-19-Patienten). Wie die statistische Analyse zeigt, gibt es zwischen der Infektion und der nachfolgenden Thrombose oder Embolie einen klaren zeitlichen Zusammenhang. Die Assoziation war in den ersten sieben Tagen nach dem positiven Testergebnis besonders stark. In dieser Zeit entwickelten die Patienten neben Venenthrombosen und Lungenembolien auch gehäuft Herzinfarkte und Hirnschläge. Das erhöhte Risiko blieb für Venenthrombosen und Lungenembolien bis zu 56 Tage nach dem positiven Testergebnis nachweisbar.
Auch andere Infektionskrankheiten wie die Grippe erhöhten das Thromboserisiko, schreiben die Forscher. Der Effekt sei bei Covid-19 aber stärker. Deshalb wird die medikamentöse Thromboseprophylaxe heute schon auf gewisse ambulante Covid-19-Patienten ausgeweitet. Das sind vor allem Personen mit weiteren Risikofaktoren für Gerinnungsprobleme. Bei ihnen kann nach verschiedenen Behandlungsempfehlungen nach Abwägen der Vor- und Nachteile eine zeitlich beschränkte Thromboseprophylaxe in Betracht gezogen werden. Sie allen anzubieten, wird wegen möglicher Blutungskomplikationen aber nicht empfohlen.
5. Februar: Bei Personen, die schon eine Sars-CoV-2-Infektion durchgemacht haben, könnte eine Impfdosis reichen
kus. · Die Impfstoffe gegen Sars-CoV-2 sind knapp, und selbst viele Risikopersonen sind noch nicht geimpft. Zwei Forschergruppen haben nun unabhängig voneinander Hinweise auf eine Möglichkeit gefunden, den Impfstoffvorrat zu strecken: Möglicherweise reicht bei Personen, die bereits einmal infiziert waren, nur eine statt zwei Impfungen.
Die Forschergruppen aus Baltimore beziehungsweise New York haben jeweils in kleinen Studien untersucht, wie das Immunsystem von Personen, die nachweislich bereits eine Sars-CoV-2-Infektion durchgemacht hatten, auf die Impfung mit mRNA-Impfstoffen reagiert. Die Resultate ähneln sich: In beiden Untersuchungen stieg die Zahl der Antikörper im Blut der Patienten rasch steil an, zudem fanden die Forscher jeweils deutlich mehr Antikörper als bei nicht vorher Infizierten, wenn sie sie zum gleichen Zeitpunkt untersuchten.
In der Studie aus New York waren die Antikörpertiter der zuvor Infizierten nach nur einer Impfung um mehr als das Zehnfache höher als der durchschnittliche Titer von Personen, die zwei Impfungen erhalten hatten, aber nie infiziert gewesen waren. Die stärkere Reaktion auf die Impfung zeigte sich demnach aber auch in den Nebenwirkungen: Die Probanden, die bereits eine Infektion durchgemacht hatten, berichteten von mehr grippeähnlichen Impfreaktionen wie Müdigkeit, Kopfschmerzen oder Fieber – ähnlich, wie es bei der zweiten Dosis der Impfung sei, schreiben die Forscher. Solche Personen nur einmal zu impfen, dürfte sie daher auch vor weiteren solchen Nebenwirkungen bewahren.
Beide Forschergruppen schliessen aus ihren Ergebnissen, dass bei zuvor schon einmal infizierten Personen eine Dosis der mRNA-Vakzine reichen dürfte, um einen mindestens ebenso guten Schutz zu erzielen, wie ihn nicht infizierte Personen nach zwei Dosen erhalten. Laut den Experten ist dieser Fund nicht überraschend. Die natürliche Infektion übernimmt in diesem Szenario die Rolle der ersten Impfdosis, die Impfung jene der Booster-Dosis – wie es nicht nur die Antikörpertiter, sondern auch die Nebenwirkungen widerspiegeln. Diese Erkenntnis in ein Massenimmunisierungsprogramm einzuarbeiten, dürfte logistisch komplex sein, kommentiert eine Immunologin aus Schottland gegenüber dem britischen Science Media Center.
2. Februar: Der AstraZeneca-Impfstoff ist im Tierversuch auch als Nasenspray wirksam
kus. · Der Impfstoff von AstraZeneca (ChAdOx1 nCoV-19) wird in Grossbritannien schon seit längerem geimpft und ist nun auch in Europa zugelassen. Er wird per Spritze verabreicht, für den vollen Schutz sind zwei Injektionen im Abstand von mehreren Wochen nötig. Nun haben Forscher der University of Oxford, der National Institutes of Health der USA und Kollegen an Hamstern und Rhesusaffen untersucht, wie das Vakzin als Nasenspray verabreicht wirkt. Studien mit anderen Impfstoffkandidaten an Tieren hatten bereits positive Ergebnisse von Nasenspray-Impfungen gezeigt.
Für die Untersuchung impften die Wissenschafter je eine Gruppe von Goldhamstern per Injektion in einen Muskel und eine andere per Nasenspray, wie sie in einem auf BioRxiv veröffentlichten Preprint beschreiben. Eine dritte Gruppe Tiere wurde mit einem Placebo-Impfstoff injiziert. Alle Tiere erhielten nur eine Dosis. Nach einer Wartezeit von 28 Tagen wurden die Tiere dann alle der gleichen Dosis Sars-CoV-2 ausgesetzt. Kurz zuvor untersuchten die Forscher noch die Antikörper-Antwort der Hamster; sie war bei den über die Nase geimpften Tiere am stärksten.
Wie sich zeigte, reduzierte die Impfung per Nasenspray die Abgabe von Viren deutlich; die Forscher fanden über die Dauer des Experiments im Nasenrachenraum der per Nasenspray geimpften Hamster sowohl weniger infektiöses Virus als auch weniger Viren-Erbgut als bei Tieren der Kontrollgruppe. Dies war bei den in den Muskel gespritzten Tieren nicht so. Dies deutet darauf hin, dass die sterilisierende Wirkung der Nasenspray-Impfung grösser ist als jene der Injektion. Vor Krankheitssymptomen waren die Tiere gleichermassen geschützt.
Eine Wiederholung des Versuchs, bei der die Tiere durch infizierte Artgenossen angesteckt wurden, zeigte in Bezug auf die Abgabe von Viren ähnliche Ergebnisse. In diesem Experiment fanden die Forscher allerdings bei drei von vier untersuchten Tieren aus der in den Muskel injizierten Gruppe schwache Krankheitszeichen in der Lunge. Wie es zu diesem Unterschied kam, ist unklar. Möglicherweise erreichten bei dieser Form der Ansteckung mehr Viren die Lungen direkt als bei der im Versuch eingesetzten künstlichen Infektion, so spekulieren die Wissenschafter.
In einem weiteren Experiment impften die Forscher dann vier Rhesusaffen per Nasenspray. Die Antikörper-Reaktion auf den Impfstoff war laut den Forschern robust, und die Impfung schützte die Lungen der Tiere vor dem Virus. Zudem gaben sie weniger Viren ab als ungeimpfte Rhesusaffen, und infektiöses Virus entdeckten die Forscher nur bei einem Tier, das insgesamt eher wenig auf die Impfung reagiert hatte. Allerdings war der Unterschied im Gegensatz zu den Goldhamstern nicht statistisch signifikant. Insgesamt stützten diese Resultate laut den Forschern die weitere Untersuchung der Impfung über die Nasenschleimhaut.
27. Januar: Die Verbreitungsgebiete von Fledermäusen «überbrücken» die Strecke zwischen dem Fundort des nächsten Verwandten von Sars-CoV-2 und Wuhan
kus. · Noch immer sind die direkten Vorfahren des neuen Coronavirus Sars-CoV-2 nicht gefunden. Damit ist auch die Frage, wie genau und über welche Stationen das Virus seinen Weg in den Menschen fand, weiterhin offen. Die nächsten Verwandten des Virus sind noch immer zwei Fledermaus-Coronaviren, die man 1500 Kilometer von Wuhan entfernt entdeckt hatte. In Wuhan wurde Sars-CoV-2 zum ersten Mal nachgewiesen. Allerdings trennten sich die Wege der beiden Viren laut Forschern bereits vor etwa 50 Jahren von jenem von Sars-CoV-2. Forscher analysierten nun weitere Coronaviren aus Fledermäusen und Schuppentieren mit Blick auf den Ursprung des Virus.
Zunächst verglichen David Robertson von der University of Glasgow und seine Kollegen die Coronaviren miteinander. Das Erbgut dieser Viren verändert sich an sich eher langsam. Allerdings können die Erreger – sollten zwei verschiedene Varianten denselben Wirt infizieren – Stücke ihres Erbguts miteinander tauschen und durch diesen Prozess sprunghaft neue Virentypen mit anders zusammengesetztem Erbgut bilden. So dürfte laut den Forschern auch eines der zwei besonders nah mit Sars-CoV-2 verwandten Viren namens RmNY02 einen Teil seines Erbguts erworben haben. Manche der Viren, die Teile ihres Genoms teilen, kommen dabei bis zu 2000 Kilometer weit entfernt voneinander vor, wie Robertson und seine Kollegen in einem Preprint auf der Internet-Plattform bioRxiv schreiben.
Nach der Genetik und dem Vorkommen der Viren untersuchte das Team auch die Verbreitungsgebiete von vier Fledermausarten. RaTG13, das über das gesamte Erbgut hin mit Sars-CoV-2 am nächsten verwandte Virus, stammt aus einer Java-Hufeisennase Rhinolophus affinis, das Virus namens RmYN02 aus der Hufeisennasenart R. malayanus. Allerdings ist das Verbreitungsgebiet von Letzterer beschränkt – im Gegensatz zu jenem der Java-Hufeisennase und der Art R. sinicus. Beide sind weit über China verbreitet, die Verbreitungsgebiete überlappen sich vollständig und schliessen all jene Orte ein, wo relevante Viren gefunden worden waren: Wuhan, die Provinz Yunnan, aus der die beiden nächsten Verwandten von Sars-CoV-2 stammen, die Fundorte der infizierten Schuppentiere. Zudem umfassen sie auch die teils weit voneinander entfernt gelegenen Fundorte der Viren, die Erbgut teilen.
Ihre Ergebnisse zeigen laut den Forschern, dass man die Probenentnahme für die Suche nach dem Ursprung von Sars-CoV-2 und weiteren potenziell gefährlichen Coronaviren geografisch breit anlegen und sich auch nicht auf eine Tierart beschränken sollte. Allerdings: Auf die Java-Hufeisennase sollte man laut den Forschern ein besonderes Augenmerk richten. Sie teile ihre Schlafstätten mit anderen Fledermausarten, was den Viren die Möglichkeit biete, neue Wirte zu infizieren, Co-Infektionen zu verursachen und dabei Erbgut auszutauschen.
21. Januar: Modellrechnung zeigt: Eine gezielte Teststrategie könnte die Quarantäne in einigen Fällen unnötig machen
ni. · Was schon lange diskutiert wird, haben britische Forscher nun in einer mathematischen Modellierung bestätigt: Mit gezielten Tests bei Personen, die sich möglicherweise mit dem neuen Coronavirus angesteckt haben, liesse sich die Quarantänedauer in vielen Fällen reduzieren oder sogar ganz verhindern. Dabei würde die Virusausbreitung kaum verstärkt, schreiben die Wissenschafter in der Fachzeitschrift «The Lancet Public Health».
Bis jetzt empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation (WHO), dass sich Personen mit einer möglichen Sars-CoV-2-Infektion für 14 Tage in Quarantäne begeben. In vielen Ländern – so auch in der Schweiz – beträgt die vorgeschriebene Dauer 10 Tage. Indem man Verdachtsfälle rasch in Quarantäne setzt, will man verhindern, dass tatsächlich angesteckte Personen das Virus weiterverbreiten können. Damit sollen möglichst viele Infektionsketten gebrochen werden.
Ein ähnlich gutes Resultat wie mit dem bisherigen Quarantäne-Regime könne man erzielen, wenn sich die Verdachtsfälle nur für 7 Tage in Quarantäne begäben und man am siebten Tag einen Test zum Nachweis von Sars-CoV-2 durchführte, schreibt die Forschergruppe von Billy Quilty von der London School of Hygiene & Tropical Medicine in ihrer Arbeit. Bei einem negativen Testergebnis könnte die Quarantäne aufgehoben werden; bei einem positiven Resultat bliebe sie bis zum offiziellen Ende bestehen.
In einer weiteren von den britischen Forschern untersuchten Quarantäne-Strategie müssten sich die Verdachtsfälle nicht von Anfang an in Selbstisolation begeben. Man würde sie aber während fünf Tagen täglich auf Sars-CoV-2 testen. Sobald ein Test positiv ausfällt, müsste sich die Person in Quarantäne begeben. Bei fünf negativen Testergebnissen wäre überhaupt keine Quarantäne nötig.
Wie mit der heutigen Quarantäne-Strategie könnten mit den zwei alternativen Test-und-Quarantäne-Regimen laut den Forschern 50 bis 60 Prozent der Virusübertragungen verhindert werden. Bei ihren Modellrechnungen gingen die Wissenschafter davon aus, dass heute nur 67 Prozent der Personen mit positivem Corona-Test die vorgeschriebene Zeit in Isolation verbringen; bei Kontaktpersonen mit lediglich einem Verdacht auf eine Infektion rechneten sie sogar nur mit 50 Prozent. Bei einer Strategie mit verkürzter Quarantäne dürfte die Motivation, sich an die Regeln zu halten, grösser sein.
Auch wenn ihre Resultate attraktive Veränderungen bei den Quarantäne-Regeln ermöglichen könnten, müssten sie mit Vorsicht interpretiert werden, schreiben die Forscher. Und sie warnen ausdrücklich davor, die Studie zum Anlass zu nehmen, um die Quarantäne-Regelung in einem Land zu ändern. Das hat gute Gründe. Denn wie immer bei Modellierungen sind die Ergebnisse von den Annahmen abhängig, mit denen die Berechnungen durchgeführt werden.
Diese Parameter können sich durch Verhaltensänderungen in der Bevölkerung und viele andere Faktoren verändern. Das erschwert auch einen Vergleich zwischen verschiedenen Ländern. Ein besonders heikler Punkt in der britischen Studie sind die Schnelltests, deren Genauigkeit je nach Produkt und Studie unterschiedlich hoch ausfällt. In der Modellierung wurden eine Sensitivität von 77 Prozent und eine solche von 49 Prozent durchgerechnet. Nur mit den zuverlässigeren Schnelltests waren die Strategien mit verkürzter Quarantäne den herkömmlichen Regelungen ebenbürtig.
11. Januar: Versammlungsverbote und Schulschliessungen reduzieren die Mobilität besonders effizient
Spe. · Die Einschränkung der Mobilität ist ein probates Mittel, die Corona-Fallzahlen zu senken. Wer sich weniger bewegt, hat in der Regel auch weniger Gelegenheiten, sich mit dem Coronavirus anzustecken oder es zu verteilen. Dass es im Frühling letzten Jahres gelang, die erste Welle der Corona-Pandemie zu brechen, lag unter anderem auch daran, dass durch den landesweit verordneten Lockdown der Bewegungsradius der Bevölkerung erheblich eingeschränkt werden konnte. Einen grossen Anteil daran hatten offenbar Versammlungsverbote, Laden- sowie Schulschliessungen. Das geht aus einer noch nicht begutachteten Publikation hervor, die Forscher der ETH Zürich am Wochenende aufs Netz gestellt haben.
Die Gruppe um Stefan Feuerriegel wertete die Daten aus, die zwischen dem 10. Februar und dem 26. April des letzten Jahres von den Schweizer Mobilfunkanbietern gesammelt wurden. Diese Daten verraten, mit welcher Antenne ein Handy zu einem bestimmten Zeitpunkt verbunden ist. Auf diese Weise konnten die Forscher 1,5 Milliarden Bewegungen im fraglichen Zeitraum rekonstruieren. Ein Vergleich mit den Bewegungsdaten des Vorjahres zeigte, dass die Mobilität durch den Lockdown um 50 Prozent abgenommen hatte.
Der Bundesrat hatte im März 2020 mit einem ganzen Bündel von Massnahmen auf die steigenden Fallzahlen reagiert. Obwohl diese im Abstand von wenigen Tagen in Kraft traten, gelang es den ETH-Forschern, dieses Knäuel mit statistischen Methoden und unter Berücksichtigung kantonaler Unterschiede zu entwirren. Laut den Ergebnissen wurde die Mobilität durch das Verbot von Versammlungen mit mehr als fünf Personen um 24,9 Prozent reduziert, durch die Schliessung von Läden und Geschäften um 22,3 Prozent und durch Schulschliessungen um 21,6 Prozent. Grenzschliessungen und das Versammlungsverbot von mehr als 100 Personen hatten hingegen eine untergeordnete Wirkung. Überraschend ist der relativ grosse Effekt der Schulschliessungen. Zum Teil ist dieser darauf zurückzuführen, dass mit den Kindern auch die Eltern und Lehrer zu Hause blieben.
In einem zweiten Schritt konnten die Forscher zeigen, dass die Bewegungsdaten ein guter Indikator für das Infektionsgeschehen sind. Geht die Mobilität um ein Prozent zurück, nehmen 7 bis 13 Tage später die Fallzahlen um 0,8 bis 1,1 Prozent ab. Durch ein regelmässiges Monitoring der Mobilfunkdaten lässt sich also vorab erkennen, ob die ergriffenen Massnahmen ausreichend sind. Anhand der Fallzahlen lässt sich das erst nach zehn Tagen beurteilen. Manchmal ist es dann schon zu spät, um korrigierend einzugreifen.
8. Januar: Eine wichtige Veränderung der stärker ansteckenden Sars-CoV-2-Varianten mindert die Wirkung der Impfung von Pfizer/Biontech nicht
kus. · Die stärker ansteckenden Varianten des neuen Sars-CoV-2 aus England und Südafrika «verdanken» ihre höhere Infektiosität vermutlich primär einer bestimmten genetischen Veränderung namens N501Y. Sie befindet sich im Spike-Protein dieser Virusvarianten – und zwar genau in dem Bereich, mit dem das Virus bei der Infektion an die Zellen andockt. Nun haben Forscher von Pfizer und der University of Texas untersucht, ob der Pfizer-Biontech-Impfstoff auch gegen Viren wirkt, die diese Mutation tragen.
Dazu analysierten sie, wie gut das Serum von 20 geimpften Personen Viren mit der Mutation im Vergleich zu solchen ohne sie neutralisiert – mit bestmöglichem Ausgang: Wie sich zeigte, bekämpfte das Serum beide Virenvarianten gleich gut. Ihre Studie – die noch nicht unabhängig wissenschaftlich begutachtet ist – veröffentlichten die Forscher auf dem Preprint-Server «bioRxiv».
Allerdings ist N501Y nicht die einzige Mutation im Spike-Protein, die die neuen Varianten aufweisen. Die Studie kann daher nicht beantworten, wie gut ein Spike-Protein erkannt wird, das jeweils alle Veränderungen der englischen oder der südafrikanischen Sars-CoV-2-Variante trägt. Die Wissenschafter verweisen aber auf eine im Dezember veröffentlichte (ebenfalls als Preprint vorliegende) Studie von Biontech-Forschern und Kollegen, in der der Impfstoff erfolgreich gegen Spike-Proteine mit einer Reihe weiterer Mutationen getestet wurde.
7. Januar: Personen mit der neuen Virusvariante haben vermutlich eine höhere Virenlast
Spe. · Immer mehr Anzeichen deuten darauf hin, dass die neue Variante von Sars-CoV-2 leichter zu übertragen ist als ältere Varianten. Warum das so ist, ist bis jetzt unklar. Forscher der University of Birmingham haben nun eine mögliche Erklärung gefunden. Die Untersuchung von 641 positiven Proben liefert den Hinweis, dass Patienten, die mit der mutierten Form des Virus infiziert sind, eine höhere Virenlast in sich tragen. Folglich stossen sie mehr Viren aus, so dass eine erhöhte Gefahr besteht, sich bei ihnen anzustecken.
Die Forscher nutzten die Tatsache, dass in dem mutierten Virus ausgerechnet eine der drei Gensequenzen verändert ist, anhand deren das Virus nachgewiesen wird. Normalerweise erkennt ein in England häufig verwendeter PCR-Test drei Sequenzen. Bei dem mutierten Virus sind es nur deren zwei. Das liefert ein einfaches Kriterium, die neue Virusvariante von der älteren zu unterscheiden.
Ein Vergleich zeigte, dass Proben mit dem mutierten Virus im Mittel eine zehn- bis hundertmal so hohe Virenkonzentration aufweisen wie Proben mit der älteren Variante. Bei einem beträchtlichen Prozentsatz der Proben waren die Unterschiede sogar noch grösser. Die Autoren merken allerdings an, dass diese quantitativen Aussagen durch unabhängige Untersuchungen bestätigt werden müssen, da das von ihnen verwendete Testverfahren dafür nicht optimal geeignet sei.
Die noch nicht begutachtete Studie der britischen Forscher liefert zwar eine plausible Erklärung dafür, warum die mutierte Virusvariante leichter übertragen wird. Nach wie vor unklar ist aber, warum sich diese Viren im Nasen- und Rachenraum stärker zu vermehren scheinen. Möglich ist, dass die Mutationen dem Virus einen Replikationsvorteil verschaffen. Es könnte aber auch sein, dass es schlechter vom Immunsystem erkannt wird.
31. Dezember: Warum Bluthochdruck das Risiko für einen schweren Verlauf von Covid-19 erhöht
slz. · Menschen mit Bluthochdruck (Hypertonie) haben laut diversen Studien ein drei- bis vierfach höheres Risiko für eine schwere Covid-19-Erkrankung. Forscher der Charité Berlin und Kollegen anderer deutscher Institute haben nun eine mögliche Ursache dafür gefunden. Die Hypertonie führe zu einem entzündlichen Zustand und diverse Zellen des Immunsystems befänden sich dadurch bereits vor einer Infektion sozusagen in erhöhter Alarmbereitschaft, erklären die Wissenschafter in einer Publikation in «Nature Biotechnology». Wenn nun der Virenansturm komme, reagiere das System über.
Es werden dann nicht nur wie erwünscht virenbefallene Zellen vernichtet, es kommt auch zu einer Zerstörung gesunden Gewebes. Erhöhte Entzündungswerte seien unabhängig vom Herz-Kreislauf-Status immer ein Warnsignal dafür, dass die Covid-19-Erkrankung schwer verlaufen werde, betonte Ulf Landmesser, einer der beteiligten Forscher. Eine beruhigende Nachricht ist allerdings, dass auch die neue Studie keine Hinweise dafür findet, dass Bluthochdruckpatienten anfälliger sind für eine Sars-CoV-2-Infektion.
Allerdings hatte die Art der medikamentösen Behandlung einen grossen Einfluss auf das Covid-19-Risiko der Studienteilnehmer. So wiesen Hypertoniker, die bereits vor der Sars-CoV-2-Infektion regelmässig ACE-Hemmer zur Regulierung ihres Blutdrucks eingenommen hatten, kein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf auf. Nahmen die Patienten hingegen andere Substanzen ein, sogenannte Angiotensin-Rezeptor-Blocker, profitierten sie bezüglich Covid-19 kaum davon: Ihr Risiko für einen schweren Verlauf war fast so hoch wie für Bluthochdruck-Betroffene, die keines dieser beiden Medikamente einnahmen.
In der ACE-Hemmer-Gruppe verlief die Entzündungsreaktion milder, und die Immunzellen waren effektiver in der Virenbekämpfung. Somit sank die Virenlast im Organismus deutlich schneller und auch auf geringere Mengen.
Die neue Arbeit bestätigt damit frühere Untersuchungen, die zeigten, dass eine Therapie mit ACE-Hemmern den Verlauf von Covid-19 nicht verschlechtert. Dies war zu Beginn der Pandemie befürchtet worden, weil Sars-CoV-2 das ACE-2-Protein als Andockstation und Helfer beim Zelleintritt verwendet. Ob es für Hypertoniker sinnvoll sei, bei einer Sars-CoV-2-Diagnose sofort ACE-Hemmer einzunehmen, dafür liefere die Studie keine Hinweise, schreiben die Autoren warnend. Man wisse nicht, wie schnell dies einen Einfluss auf den Zustand des Immunsystems habe. Um diese Frage zu klären, sind bereits klinische Untersuchungen eingeleitet worden.
30. Dezember: Coronavirus kann bei Kindern zu starker Entzündungsreaktion führen
(sda) Kinder, die sich mit dem Coronavirus anstecken, haben meist keine oder nur milde Symptome. Mehrere Wochen nach der Ansteckung kann aber in sehr seltenen Fällen eine Entzündungsreaktion auftreten, ein sogenanntes Pädiatrisches multisystemisches inflammatorisches Syndrom (Pims). Die Schweizer Kinderspitäler behandelten in den vergangenen Wochen mehrere Fälle.
Dabei kommt es zu einer Überreaktion des Immunsystems mit tagelangem hohem Fieber, wie das Zürcher Universitäts-Kinderspital am Mittwoch schrieb. Häufig leiden die Patienten neben Fieber auch an Bauchschmerzen, Erbrechen, Durchfall und Ausschlägen. Erstmals war die Krankheit in der Schweiz im Mai festgestellt worden, nach der ersten Pandemiewelle. Die Symptome sind ähnlich wie beim Kawasaki-Syndrom.
In der zweiten Coronavirus-Welle stellten Kinder-Intensivstationen dann eine Zunahme von Pims-Fällen fest. Über sechzig Kinder mit der Krankheit wurden bisher behandelt, die meisten von ihnen in den vergangenen paar Wochen. Insgesamt sei die Krankheit selten, hiess es in der Mitteilung.
Erhielten die kleinen Patientinnen und Patienten frühzeitig eine antiinflammatorische Behandlung, erholten sie sich in der Regel rasch und vollständig. Fachleute haben nun Richtlinien erlassen, damit alle von Pims betroffenen Kinder dieselbe Behandlung erhalten, und zwar eine, die auf dem neusten Stand des Wissens beruht.
Kinder, bei denen der Verdacht auf Pims besteht, sollen gemäss Mitteilung zum Kinderarzt, zur Kinderärztin oder auf eine Notfallstation gebracht werden. Die Schutzmassnahmen für Kinder wegen des Coronavirus gelten dabei weiterhin.
30. Dezember: Grossbritannien und Argentinien lassen Corona-Impfstoff von AstraZeneca zu
(dpa) Grossbritannien und Argentinien haben den Corona-Impfstoff der Universität Oxford und des Pharmakonzerns AstraZeneca zugelassen. Das Mittel hatte in Studien eine geringere Wirksamkeit aufgewiesen als der bereits zugelassene Impfstoff von Biontech und Pfizer, kann allerdings bei Kühlschranktemperaturen gelagert werden und ist deutlich günstiger. In Grossbritannien sollen bereits am 4. Januar die ersten Impfungen stattfinden.
Das Vakzin soll nach den ersten Studiendaten im Mittel einen 70-prozentigen Schutz vor Covid-19 bieten. Bei spezieller Dosierung könnte die Wirksamkeit laut dem Konzern womöglich noch deutlich höher liegen. Zeitweise waren Zweifel am Studiendesign und an der unterschiedlichen Wirksamkeit des Impfstoffs in verschiedenen Teilstudien aufgekommen. Der schwedisch-britische Konzern hatte daher zusätzliche Untersuchungen durchgeführt.
Anders als die Vakzine der Mainzer Firma Biontech und des US-Pharmakonzerns Pfizer sowie der amerikanischen Firma Moderna gehört das britisch-schwedische Präparat nicht zu den mRNA-Impfstoffen. Der Wirkstoff AZD1222 beruht auf der abgeschwächten Version eines Erkältungsvirus von Schimpansen. Es enthält genetisches Material eines Oberflächenproteins, mit dem der Erreger Sars-CoV-2 an menschliche Zellen andockt. Das Mittel wirkt zweifach: Es soll sowohl die Bildung von spezifischen Antikörpern als auch von sogenannten T-Zellen fördern – beide sind für die Immunabwehr wichtig.
26. Dezember: Wie die Stärken und Schwächen verschiedener Corona-Tests nutzbringend eingesetzt werden könnten
kus. · Zwei Wissenschafter aus den USA rufen in der Fachzeitschrift «Science» dazu auf, die jeweiligen Qualitäten der verschiedenen Corona-Tests auszunützen und sie stärker für Überwachungs- und Screening-Programme einzusetzen, als dies bis jetzt der Fall sei. Corona-Tests sollten als Werkzeug für die öffentliche Gesundheit dienen, fordern sie. Bis anhin setze man in vielen westlichen Ländern die Tests primär diagnostisch ein, also um herauszufinden, ob ein bestimmtes Individuum infiziert sei, schreiben Michael Mina und Kristian Andersen in ihrem Artikel.
Es gibt ihrer Ansicht nach aber weitere wichtige Gründe, Personen auf eine Infektion mit Sars-CoV-2 zu testen: etwa, um infizierte Personen in einem bestimmten Kontext zu erkennen – beispielsweise unter den Besuchern eines Seniorenheims. Den benutzten Test sollte man je nach Situation anpassen. Für die Diagnostik eignen sich demnach PCR-Tests oder bei symptomatisch Infizierten auch Antigen-Schnelltests. Für Besucher-Screenings wiederum ist die Schnelligkeit wichtig. Der verwendete Test müsste zudem dem Kontext angepasst werden, schreiben die Forscher. Um beispielsweise Besucher eines Seniorenheims zu filtern, müssten Tests sehr genau sein, weil die betagten Bewohner ein hohes Risiko hätten, schwer zu erkranken. Sie sollten zudem – unabhängig vom Kontext – immer mit den üblichen Hygiene- und Abstandsmassnahmen kombiniert werden.
Ganz speziell sprechen sie sich aber für Überwachungsprogramme aus, in denen regelmässig grosse Teile der Bevölkerung getestet werden, um infizierte Personen zu identifizieren und Auskunft über die Verbreitung des Virus zu bekommen. Sie verweisen hier auf die Massentests in der Slowakei. Diese haben laut einer noch nicht begutachteten Vorveröffentlichung die Inzidenz zwei Wochen nach der ersten, versuchsweisen Testreihe um etwa 80 Prozent gesenkt. Machen liessen sich solche Projekte nach Meinung der beiden Forscher, indem beispielsweise Tests nach Hause geschickt oder an stark frequentierten Orten durchgeführt würden. Hier sei es weniger wichtig, alle infizierten Personen zu finden, als jene zu entdecken, die das Virus weitergeben könnten, schreiben die Forscher.
«Solche Massentests, bei denen sich Personen zu Hause und immer wieder testeten, erforderten schnelle, billige und einfache Tests, die sich dazu eigneten, grosse Mengen asymptomatischer Personen zu testen. Es gelte, innovativ zu sein, existierende Tests zu produzieren, zu verteilen und ständig zu verbessern, um Leben zu retten und die Covid-19-Pandemie unter Kontrolle zu bringen, appellieren sie.»
24. Dezember: Spezielle Immunzellen schützen Ungeborene vor Ansteckung
slz. · Eine beruhigende und eine unerwartete Nachricht haben Bostoner Forscher für Schwangere, die sich im letzten Drittel ihrer Schwangerschaft mit Sars-CoV-2 infiziert haben. Bei keiner der 64 untersuchten Frauen kam es zu einer Übertragung des Virus auf das Ungeborene in der Gebärmutter. Das war sowohl bei Frauen mit einer asymptomatischen als auch bei jenen mit einer leichten, mittelschweren oder gar kritischen Erkrankung der Fall. Auch fanden sich in keiner Plazenta Coronaviren.
Frühere Studien mit Influenzainfektionen lassen vermuten, dass während einer Schwangerschaft spezielle Immunzellen in grösseren Mengen gebildet werden, die von Viren befallene Körperzellen vernichten. Diese Immunzellen nisten sich auch in der Plazenta ein und bilden dort einen zellulären Schutzwall für das Ungeborene.
Allerdings war das Risiko für eine Minderdurchblutung der Plazenta bei infizierten Frauen ungefähr doppelt so hoch wie bei virenfreien Kontrollpersonen. Experten vermuten, dass dies auf die erhöhte Neigung zu Mini-Blutgerinnseln durch eine Sars-CoV-2-Infektion zurückzuführen ist. Die neue Studie bestätigt damit frühere Beobachtungen.
Erfreulich sei auch, dass bei keiner infizierten Schwangeren eine überbordende Anzahl an Viren im Blut und eine grossflächige Verteilung der Viren im ganzen Körper, eine sogenannte Virämie, festgestellt worden seien, betonen die Forscher. Andere Studien melden, dass bis zu 15 Prozent der Covid-19-Patienten eine solche Virämie aufweisen.
Überraschend für die Wissenschafter war die Tatsache, dass die Babys infizierter Mütter unerwartet wenig Anti-Sars-CoV-2-Antikörper in ihrem But aufwiesen, obwohl die Frauen Antikörper gebildet hatten. Hingegen fanden sich Anti-Influenza-Antikörper, die ebenfalls im Blut der Mütter zirkulierten und offenbar nach einer Impfung gebildet worden waren, in höheren Mengen im Blut der Neugeborenen. Das wirft die Frage auf, ob Schwangere, wenn sie denn gegen das neue Coronavirus geimpft werden – nicht in allen Ländern ist die Vakzine für sie zugelassen –, überhaupt einen guten Antikörper-Schutz an ihr Kind weitergeben. Trotzdem sollten Schwangere die Impfung, wenn sie nachgewiesenermassen sicher sei, erhalten, sagen die Autoren. Denn eine Covid-19-Erkrankung könne das Risiko für eine Frühgeburt erhöhen.
18. Dezember: Dreimal so hohes Sterberisiko durch Covid-19: Bisher grösste Studie zeigt wichtige Unterschiede zu Influenza
ni. · Rechtzeitig vor dem Impfstart in vielen Ländern erscheinen die Resultate einer Studie, die Unentschlossene vielleicht doch noch für die Immunisierung gegen das neue Coronavirus motivieren könnten. Denn die neuen Daten aus Frankreich machen einmal mehr deutlich, dass Covid-19 keine harmlose Krankheit ist. Das gleiche Bild haben zwar schon andere Untersuchungen vermittelt. Aber noch nie basierten die Aussagen auf einer so grossen Datenmenge.
Für ihre Studie analysierten Catherine Quantin vom Universitätsspital Dijon und ihre Kollegen die klinischen Informationen von mehr als 130 000 hospitalisierten Patienten. Solche Informationen werden in Frankreich von allen öffentlichen und privaten Spitälern in eine nationale Datenbank eingespeist. Knapp 90 000 der Spitalpatienten waren diesen Frühling in Frankreich wegen Covid-19 hospitalisiert gewesen. Die restlichen gut 45 000 Personen hatten in der Grippesaison 2018/19 wegen Influenza ein Spital aufsuchen müssen.
Im Vergleich zu den hospitalisierten Grippepatienten hatten die Covid-19-Patienten in den Spitälern ein dreimal so hohes Sterberisiko (17 Prozent gegenüber 6 Prozent). Zudem: Bei Covid-19 entwickelte ein grösserer Teil der Patienten eine so schwere Erkrankung, dass sie auf der Intensivstation behandelt werden mussten (16 Prozent gegenüber 11 Prozent). Der Aufenthalt auf der Intensivstation dauerte im Fall von Covid-19 fast doppelt so lange (15 Tage gegenüber 8 Tagen).
Laut den Studienautoren dürften die festgestellten Unterschiede vor allem darauf zurückzuführen sein, dass bei der Influenza die Bevölkerung über einen gewissen Immunschutz verfügte. Dieser stammt von der jährlichen Grippeimpfung wie auch von früheren Begegnungen mit ähnlichen Influenzaviren (Kreuzimmunität). Beim pandemischen Coronavirus Sars-CoV-2, einem neuartigen Krankheitserreger, habe die Bevölkerung keine Immunität gehabt, schreiben die Forscher.
Um die in der Fachzeitschrift «The Lancet Respiratory Medicine» erschienenen Resultate einordnen zu können, müsste man wissen, wie repräsentativ die von den französischen Forschern untersuchte Grippesaison war. Es ist schliesslich bekannt, dass die grippebedingten Todesfallzahlen je nach zirkulierenden Influenzaviren und Wirksamkeit der jährlich zusammengestellten Grippeimpfung stark variieren können. Zu diesem Punkt befragt, sagt die Studienleiterin Quantin in einer Medienmitteilung, dass die Grippesaison 2018/19 in Frankreich die schwerste in den letzten fünf Jahren gewesen sei.
In einem begleitenden Kommentar zur französischen Arbeit schreibt Eskild Petersen von der Universität Aarhus in Dänemark, dass man davon ausgehen könne, dass die Indikationen für eine Hospitalisation in den beiden Untersuchungszeiträumen gleich gewesen seien. Eine Verzerrung der Resultate sei daher nicht anzunehmen. Für Petersen sprechen die Ergebnisse klar dafür, dass Covid-19 eine schwerere Erkrankung ist als die saisonale Grippe.
In einem Bereich hält die französische Studie dennoch gute Nachrichten bereit. So mussten in den untersuchten Monaten deutlich weniger Kinder unter 18 Jahren wegen Covid-19 hospitalisiert werden, als dies bei der Grippe der Fall war (1 Prozent gegenüber 20 Prozent). Zudem war die Sterberate für kleine Kinder bei beiden Krankheiten vergleichbar und sehr tief.
17. Dezember: Erstmals ein mit Sars-CoV-2 infiziertes Wildtier gefunden
kus. · In den USA ist zum ersten Mal überhaupt ein mit Sars-CoV-2 infiziertes Wildtier identifiziert worden, wie der USDA Animal and Plant Health Inspection Service vor einer knappen Woche meldete. Die Infektion sei vom nationalen Veterinärlabor bestätigt worden. Es handelt sich um einen wilden Nerz. Entdeckt wurde das Tier laut der Meldung im Rahmen der Überwachung von Nerzfarmen, auf denen Sars-CoV-2 ausgebrochen war. Das aus dem Tier isolierte Virus sei nicht von denjenigen auf der betroffenen Farm zu unterscheiden, in deren Nähe es gefunden wurde.
Im Rahmen des Überwachungsprogramms untersuchten die Forscher von Ende August bis Ende Oktober in drei Gliedstaaten der USA verschiedene Tierarten in der Umgebung betroffener Farmen auf eine Infektion mit dem Virus. Bis anhin gebe es keine Hinweise darauf, dass das Virus in der Umgebung der Farmen zirkuliere oder sich in wilden Populationen etabliert habe, heisst es weiter. Alle anderen untersuchten Wildtiere seien negativ auf Sars-CoV-2 gewesen.
Die Forscher fordern nun dazu auf, Anstrengungen zu unternehmen, um zu verhindern, dass sich das Virus in den wilden amerikanischen Nerzbeständen etablieren kann. Dass ein Überspringen auf eine Wildtierart nicht stattfinden sollte, gilt laut Experten aber allgemein. Die Sorge dabei ist einerseits, dass es über infizierte Wildtiere in gefährdete, möglicherweise für das Virus empfindliche Bestände geraten könnte. Andererseits könnte sich so ein schwer kontrollierbares Reservoir des Erregers bilden. Der Fund bestätigt laut Christian Griot vom Institut für Virologie und Immunologie des EDI und der Universität Bern, dass es wichtig ist, die Tiere auf betroffenen Farmen zu keulen, um eine mögliche Ausbreitung in Wildtierpopulationen zu verhindern.
Bis anhin haben sich diverse Tiere in menschlicher Obhut als empfänglich für Sars-CoV-2 erwiesen – von Grosskatzen in Zoos über Hauskatzen bis zu Nerzen auf Pelzfarmen und Versuchstieren. Schwere Erkrankungen der Tiere sind aber selten, und man geht davon aus, dass solche Infektionen nicht zum Pandemiegeschehen beitragen.
15. Dezember: Eine neue Virusvariante breitet sich in England aus
kus. · Im Süden und Südosten Englands breitet sich zurzeit eine Variante von Sars-CoV-2 namens «VUI – 202012/01» mit spezifischen genetischen Veränderungen rasch aus. Ob die rasante Ausbreitung allerdings an der speziellen Kombination von Mutationen in dieser Variante liegt oder an zufälligen Ereignissen beim Ausbreitungsgeschehen, ist noch unklar und wird zurzeit untersucht. Bis anhin gibt es laut Public Health England keine Hinweise darauf, dass die Variante Einfluss auf die Schwere der Erkrankung, auf die Antikörperantwort oder die Wirksamkeit der Impfungen hat.
Der Virusvariante fehlen zwei Aminosäuren im sogenannten Spike-Protein, mit dem das Virus bei der Infektion an seine Wirtszelle bindet, wie Ravindra Gupta von der University of Cambridge und seine Kollegen in einer Vorabveröffentlichung auf dem Preprint-Server «BioRxiv» schreiben. Veränderungen in diesem Protein werden besonders genau beobachtet, weil es ein wichtiges Ziel der Immunantwort ist und sich auch die Impfungen gegen das Spike-Protein richten.
Die Mutation namens ΔH69/ΔV70 ist im Verlauf der Pandemie laut Gupta bereits mehrfach bei Sars-CoV-2 aufgetaucht; im Spike-Protein dieser Viren war es bereits vorher zu anderen wichtigen Mutationen gekommen. Dies war auch bei der nun in England identifizierten Variante der Fall. Sie besass bereits eine N501Y genannte Veränderung in der Rezeptorbindungsdomäne, zu der dann erst ΔH69/ΔV70 und später noch fünf weitere Mutationen im Spike-Protein hinzukamen. Seit August breitet sich diese Variante dort nun verstärkt aus, was ein Hinweis darauf sein könnte, dass sie infektiöser ist als die anderen zurzeit dort zirkulierenden Sars-CoV-2.
Tatsächlich könnte das Fehlen der Aminosäuren laut den Forschern die 3-D-Struktur der Stelle auf dem Spike-Protein beeinflussen, mit der das Virus an die Zelle bindet, die sogenannte Rezeptorbindungsdomäne. Dies wiederum könnte die Bindung des Virus an die Zelle und damit dessen Infektiosität beeinflussen oder dem Virus durch die Veränderung am Spike-Protein erlauben, einigen Antikörpern auszuweichen, wie Gupta erklärt.
Laut Experten ist die Tatsache, dass sich das Virus verändert, allerdings zunächst einmal nicht bedenklich. Das genetische Material von Viren verändert sich stetig. Entsprechend tauchen immer wieder Varianten mit neuen Mutationen auf, seit Sars-CoV-2 den Sprung in den Menschen geschafft hat. Die zurzeit kursierenden Viren unterscheiden sich laut Schätzungen von Experten deshalb jeweils an etwa einem guten Dutzend Stellen von den ersten sequenzierten Erregern. Bestimmte Varianten konnten sich dabei besonders gut durchsetzen. Nicht klar ist, ob dies an Eigenschaften des betreffenden Virus oder an zufälligen Ereignissen liegt. So können etwa Superspreader-Ereignisse einer Virusvariante unabhängig von deren genetisch determinierten Eigenschaften besonderen Schub verleihen.
Dass die neue Virusvariante allerdings gleich so viele Mutationen in ihrem Spike-Protein vereinigt, lässt die Experten aufhorchen und gibt Grund, ihr erhöhte Aufmerksamkeit zu schenken. Public Health England plant, innert der nächsten zwei Wochen erste Resultate der Evaluationen bekanntzugeben, die gemeinsam mit Forschungspartnern durchgeführt werden.
14. Dezember: Die Maskenpflicht könnte in Deutschland die Zahl der Neuinfektionen deutlich reduziert haben
kus. · Studien zum Effekt des Maskentragens auf die Entwicklung der Sars-CoV-2-Pandemie haben oft das Problem, dass eine reale Kontrollgruppe fehlt. Oft wurde die Massnahme direkt flächendeckend eingeführt, oder man muss von experimentellen Untersuchungen auf das Leben extrapolieren. In einer nun in der Fachzeitschrift «PNAS» publizierten Untersuchung sind Klaus Wälde von der Universität Mainz und seine Kollegen das Problem mit sogenannt synthetischen Kontrollgruppen angegangen – und haben beträchtliche positive Effekte der Maskenpflicht auf das Infektionsgeschehen gefunden.
Sie nutzten dabei aus, dass die Stadt Jena und später auch einige Landkreise die Maskenpflicht in öV und Läden einführten, bevor dies bundesweit der Fall war. Mithilfe der synthetischen Kontrollmethode suchten die Forscher dann deutschlandweit nach Orten und Kreisen, die Jena und den anderen Städten und Kreisen mit früher Maskenpflicht sowohl vom Infektionsgeschehen als auch von der Demografie und anderen Punkten her möglichst ähnlich waren. Für Jena fanden sie sechs, die dann – nach Ähnlichkeit gewichtet – als Kontrollgruppe dienten. Schliesslich verglichen Wälde und seine Kollegen, wie sich die Infektion in den Gegenden und Orten mit und ohne Maskenpflicht entwickelte.
In Jena war der Effekt beeindruckend: Über alle Altersgruppen senkten die Masken die Zahl der Neuinfektionen im Vergleich zu der Kontrollgruppe ohne Maskenpflicht in den ersten 20 Tagen nach der Implementation der Maskenpflicht um 75 Prozent und bei den über 60-Jährigen gar um 90 Prozent. Dies könne auch daran liegen, dass die Masken der Bevölkerung zu einem besonders frühen Zeitpunkt in der Pandemie den Ernst der Lage im wahrsten Sinne des Wortes vor Augen geführt hätten und diese dadurch insgesamt vorsichtiger geworden sei, sagt Wälde. Bei einem Vergleich von Landkreisen, in denen die Menschen ebenfalls früh Masken trugen, mit solchen, die die Maskenpflicht erst später einführten, war der Effekt deutlich kleiner: Er lag nur bei etwa 15 Prozent. Allerdings habe hier die Kontrollgruppe weniger gut zur Masken-Gruppe gepasst als im Fall von Jena, erklärt Wälde. Ein Vergleich, der sich auf Stadtkreise beschränkte, habe dagegen wieder eine Reduktion der Neuinfektionen um knapp 50 Prozent ergeben.
Insgesamt gehen die Forscher aufgrund ihrer Resultate davon aus, dass die Masken einen beträchtlichen – und zudem verhältnismässig kostengünstigen – Beitrag zur Kontrolle der Pandemie leisten. Zu einem ähnlichen Ergebnis waren kürzlich auch kanadische Forscher gekommen. Sie hatten in ihrer Untersuchung in den ersten Wochen nach der Einführung einer Maskenpflicht eine Reduktion der wöchentlichen Neuinfektionen um etwa 25 Prozent gefunden.
10. Dezember: Nach AstraZeneca/Oxford publizieren auch Biontech und Pfizer die Ergebnisse ihrer Impfstoffstudie
rtz. · Biontech und Pfizer haben heute Daten zu Sicherheit und Wirksamkeit ihres Covid-19-Impfstoffkandidaten BNT162b2 veröffentlicht. Die Studie erscheint im «New England Journal of Medicine». An der für eine allfällige Zulassung ausschlaggebenden Phase-III-Studie nahmen 43 448 Teilnehmer ab 16 Jahren teil. Jeweils die Hälfte von ihnen erhielten den Impfstoff BNT162b2 oder ein Placebo.
Die Impfung bestand aus zwei Dosen im Abstand von 21 Tagen. Die Studie weist dem Impfstoff sowohl eine gute Verträglichkeit als auch einen hohen, nämlich 95-prozentigen Schutz gegen eine Infektion mit dem Sars-CoV-2-Virus aus. Die Wirksamkeit der Impfung sei über alle Altersgruppen, beide Geschlechter und alle Body-Mass-Index-Gruppen hinweg konsistent. Als Nebenwirkungen den Impfung traten Erschöpfung (3,8 Prozent) und Kopfschmerzen (2,0 Prozent) und gelegentlich Fieber auf (16 Prozent bei jüngeren, 11 Prozent bei älteren Probanden). Schwerwiegende Nebenwirkungen waren mit 0,6 Prozent selten; diese wurden im selben Umfang in der Placebogruppebeobachtet.
Ergebnisse zur langfristigen Sicherheit der Impfung, zur Dauer des Impfschutzes und zur Wirksamkeit gegen asymptomatische Sars-CoV-2-Infektionen liegen noch nicht vor, es werden aber in den kommenden Monaten weitere Ergebnisse erwartet. Gleiches gilt für Daten zur Eignung der Impfung für Jugendliche, Schwangere, Kinder und bestimmte Risikogruppen wie etwa immunsupprimierte Menschen.
9. Dezember: Baumwollmasken sind Papier überlegen – jedenfalls nach 20-maligem Waschen
sda/rtz. · Es ist die Gretchenfrage der Stunde: Stoff oder Papier – was ist besser für die Umwelt? Empa-Forschende haben Baumwollmasken und Einwegmasken einer Ökobilanzanalyse unterzogen. Fazit: Die Stoffmaske siegt – sofern sie mindestens 20 Wäschen überdauert.
Die Forscher verglichen die Treibhausgasbilanz, den Energieverbrauch, den Wasserverbrauch sowie die Gesamtumweltbelastung (ausgedrückt in sogenannten Umweltbelastungspunkten, UBP) von Produktion, Nutzung und Entsorgung der Masken. Dabei wurden die Effekte für eine Person betrachtet, die während einer Woche täglich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit fährt und dreimal Einkäufe erledigt. Basierend auf den Empfehlungen der Swiss National Covid-19 Science Task Force nutzt diese Person pro Woche entweder zwei Stoffmasken, die nach Gebrauch bei 60 °C gewaschen und nach fünfmaligem Waschen entsorgt werden, oder 13 chirurgische Einwegmasken aus Polypropylen.
Die Berechnungen zeigen, dass die Baumwoll-Stoffmasken bezüglich Energieverbrauch und Treibhausgasbilanz besser abschneiden als die chirurgischen Masken. Demgegenüber schneidet die chirurgische Maske bezüglich Wasserverbrauch und Gesamtumweltbelastung besser ab als das Pendant aus Baumwolle. «Der Grund dafür ist die wenig nachhaltige, ressourcenintensive Baumwollproduktion», sagt der Empa-Forscher Roland Hischier. Bei Verwendung von Biobaumwolle oder rezyklierter Baumwolle sähe der Wasserfussabdruck der Baumwollmasken deutlich besser aus. Das Waschen der Stoffmasken fällt, verglichen mit der Produktion, kaum ins Gewicht. Insbesondere spielt es gemäss den Analysen der Forscher praktisch keine Rolle, bei wie viel Grad die Maske gewaschen wird.
8. Dezember: Erste wissenschaftliche Publikation zur Wirksamkeit eines Impfstoffs
slz. · Nun lässt sich die Erfolgsmeldung über den Impfstoff der University of Oxford und ihres Big-Pharma-Partners AstraZeneca überprüfen: Am Dienstag wurden die Daten von rund der Hälfte der mehr als 23 000 Probanden aus Grossbritannien, Brasilien und Südafrika in der Fachzeitschrift «The Lancet» veröffentlicht. Es ist die erste umfangreiche und zudem von Experten begutachtete Publikation von Studiendaten eines Corona-Impfstoffs überhaupt.
Offenbar schützt die Vakzine vor allem vor einer Covid-19-Erkrankung mit Symptomen. Weniger klar ist hingegen, ob zwei Impfdosen auch ebenso effizient vor einer symptomlosen Erkrankung schützen. Ebenso unklar bleibt, ob die Vakzine Menschen über 55 vor einer Sars-CoV-2-Infektion schützen kann. Noch habe man zu wenig ältere Personen geimpft, um statistisch belastbare Aussagen zu bekommen, schreiben die Autoren.
In der Publikation werden die schon vorab in einer Pressemitteilung präsentierten Daten zur Schutzwirkung ebenso aufgeschlüsselt wie Daten zu Nebenwirkungen. Die Vakzine sei sehr sicher, betonen die Oxford-Forscher. So meldeten zwar 168 Studienteilnehmer schwere Nebenwirkungen. Doch nur ein Fall sei auf die Vakzine zurückzuführen. Einen weiteren Fall habe man noch nicht zugeordnet, da die Studie ja noch weiterlaufe.
Schon bei der Vorabveröffentlichung einiger Daten hatte ein Ergebnis für Kopfschütteln gesorgt: Die Schutzwirkung der Oxford-Vakzine war nämlich deutlich grösser, wenn die Probanden zuerst eine niedrige und dann eine hohe Dosis bekamen. Diese Verabreichung war ein Zufallsprodukt, weil es bei manchen Impfdosen zu einer falschen Berechnung der Konzentration gekommen war und daher manche Injektionen weniger Virusbestandteile enthielten. Es bleibt nach wie vor ein Rätsel, warum die Kombination aus einer niedrigen und einer hohen Dosierung einen bessere Immunschutz auslöst. Ebenso unerklärlich bleibt vorerst, warum ein Abstand von mehr als sechs Wochen zwischen den zwei Injektionen einen etwas höheren Schutz erzielte als ein kürzerer Abstand. Somit wirft die Impfstudie auch neue Fragen zum optimalen Impfregime auf.
2. Dezember: Wie das Coronavirus ins Gehirn gelangt
ni. · Es wurde schon länger vermutet, jetzt liefert eine deutsche Forschergruppe Beweise: Das neue Coronavirus, Sars-CoV-2, kann bei infizierten Personen über Nervenzellen in der Nasen-Riechschleimhaut ins Gehirn gelangen. Diese Fähigkeit des Erregers könnte laut den Wissenschaftern einige der neurologischen Symptome wie Riech- und Geschmacksverlust, Kopfschmerzen, Müdigkeit oder Schlechtsein erklären, unter denen nicht wenige Covid-19-Patienten leiden.
Bereits in früheren Studien hatten Forscher bei Patienten Erbgut von Sars-CoV-2 im Gehirn und in der Hirn- und Rückenmarksflüssigkeit nachgewiesen. Wie das Virus aber ins Zentralnervensystem vorgedrungen ist, blieb offen. Dieser Frage ging die Forschergruppe von Frank Heppner von der Berliner Charité mit einer in der Fachzeitschrift «Nature Neuroscience» veröffentlichten Autopsiestudie nach. Die 33 untersuchten Patienten waren in der Charité oder im Universitätsspital Göttingen mit der Diagnose Covid-19 gestorben. Sie waren im Schnitt 72 Jahre alt geworden und 31 Tage nach Beginn der Corona-Symptome gestorben.
Die Wissenschafter entnahmen bei den Toten Gewebeproben aus dem Nasen-Rachen-Raum und verschiedenen Regionen des Gehirns. In vielen Proben konnten sie das Erbgut von Sars-CoV-2 wie auch einen wichtigen Eiweissstoff des Erregers, das Spike-Protein, nachweisen. Im Nasen-Rachen-Raum fanden sich zudem in und um Zellen herum intakte Viruspartikel. Diese machten die Forscher – nach eigenen Angaben weltweit erstmals – mithilfe elektronenmikroskopischer Aufnahmen sichtbar.
Am meisten Coronaviren gab es im oberen Teil der Nasenhöhle, dort, wo die Riechschleimhaut ihren Sitz hat. In diesem Bereich finden sich die Riechzellen und die von ihnen ausgehenden Nervenfasern. Sie formieren sich zum paarig angelegten Riechnerv, der ins Gehirn zieht. Über diese Nervenzellen könne Sars-CoV-2 ins Zentralnervensystem gelangen, schreiben die Berliner Wissenschafter. Eine weitere Eintrittspforte sehen sie in den kleinen Blutgefässen, die in der nasalen Riechschleimhaut in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Nervenzellen liegen. Auch über diesen Weg dürften die Viren ins Gehirn und in andere Organe des Patienten gelangen.
Trotz ihren Befunden warnen die Forscher vor einer Überinterpretation der Ergebnisse. Die untersuchten Probanden seien vor ihrem Tod alle sehr schwer an Covid-19 erkrankt. Ob das Virus auch bei Patienten mit leichten oder mittelschweren Symptomen ins Gehirn gelange, sei damit nicht geklärt. Zudem hätten neben dem Pandemievirus auch andere Mikroorganismen wie Herpesviren oder der Tollwuterreger die Fähigkeit, nach einer Infektion ins Gehirn des Patienten vorzustossen – mit zum Teil gravierenden Folgen.
1. Dezember: Forscher arbeiten an kombinierter Masern-Corona-Impfung
ni. · Die Idee ist nicht abwegig: Statt ein «harmloses» Transportvirus einzusetzen, um zu Impfzwecken Erbgut von Sars-CoV-2 in den Körper von Impfwilligen einzubringen, könnte man dafür auch abgeschwächte Masernviren verwenden – am besten die gleichen, wie sie bei den weltweiten Impfprogrammen gegen die Infektionskrankheit zum Einsatz kommen. Diese Idee verfolgt ein Team unter der Leitung von Michael Mühlebach vom Paul-Ehrlich-Institut in Deutschland.
Wie die Wissenschafter in der amerikanischen Fachzeitschrift «PNAS» schreiben, bestückten sie das Masernimpfvirus zusätzlich mit dem Gen für das Spike-Protein des pandemischen Coronavirus. Diese Doppel-Vakzine testeten sie an Mäusen und Hamstern, die auf die Immunisierung mit der Bildung von neutralisierenden Antikörpern reagierten und auch sogenannte zytotoxische T-Zellen bildeten. Die für den Impferfolg bedeutsamen Immunzellen waren im Labor in der Lage, selektiv Zellen mit dem Sars-CoV-2-Spike-Protein auf der Oberfläche abzutöten. Wie weitere Experimente zeigten, erkrankten geimpfte Tiere nach der Exposition mit dem Coronavirus weniger schwer als ungeimpfte Nager.
Welche Wirkung eine solche Doppel-Vakzine beim Menschen entfalten würde, ist mit diesen frühen Tests an Labortieren noch völlig offen. Dafür brauchte es erst aussagekräftige klinische Studien. Die deutschen Forscher schreiben, dass sich ihr Doppelansatz insbesondere für arme Länder anbieten könnte. Denn dort sind in der Corona-Pandemie vielerorts die Masern-Impfkampagnen gestoppt worden. Mit einem doppelten Impfstoff könnten somit zwei wichtige Public-Health-Probleme gleichzeitig angegangen werden.
Weniger sinnvoll dürfte es dagegen sein, schon gegen Masern geimpfte Personen mit einem solchen Impfstoff zu immunisieren. Erstens hält der Impfschutz bei der Masernimpfung meistens lebenslang an, weshalb eine Auffrischung nicht nötig ist. Zweitens könnte sich bei einer gegen Masern immunen Person die Wirksamkeit gegen Sars-CoV-2 reduzieren. Dies, weil das gegen das Masernvirus aktivierte Immunsystem darauf bedacht ist, das Impfvirus – und damit auch die Genfähre für das Corona-Spike-Protein – so rasch wie möglich zu eliminieren.
24. November: Künstliche Intelligenz «sieht» Covid-19 auf Röntgenbildern
ni. · Forscher der Northwestern University in Illinois haben künstliche Intelligenz (KI) eingesetzt, um konventionelle Röntgenbilder der Lunge auf Covid-19 zu untersuchen. Wie die Wissenschafter in der Fachzeitschrift «Radiology» schreiben, gelang dies überaus erfolgreich. So war der eingesetzte Algorithmus namens Deep-Covid-XR nicht nur zehnmal schneller als ausgebildete Radiologen. Auch bei der Trefferquote schnitt die Maschine besser ab.
Für die Beurteilung von 300 zufällig ausgewählten Röntgenbildern brauchten die fünf Radiologen zweieinhalb bis dreieinhalb Stunden. Die KI schaffte die gleiche Aufgabe in 18 Minuten. Lag die Trefferquote der Fachärzte bei 76 bis 81 Prozent, erreichte der Algorithmus 82 Prozent. Dieses Ergebnis erzielte die KI, nachdem sie die Forscher an 17 000 Röntgenbildern trainiert und validiert hatten. Damit hat der Algorithmus das grösste klinische Datenset an Lungenröntgenbildern in der Covid-19-Ära analysiert, wie die Forscher schreiben.
Die Wissenschafter haben ihren Algorithmus öffentlich zugänglich gemacht. Sie hoffen, dass Interessierte ihn benützen und mit weiteren Daten trainieren. Die Northwestern-University-Forscher sind überzeugt davon, dass ihre KI Ärzte bei der täglichen Arbeit unterstützen kann. Denn bei Spitaleintritt wird sehr oft ein Röntgenbild der Lungen angefertigt – nicht nur bei Personen mit Verdacht auf Covid-19, sondern bei einer Vielzahl von Gesundheitsstörungen. In diesen Fällen könne die KI die Mediziner innert Sekunden auf eine mögliche Infektion mit Sars-CoV-2 hinweisen. So könnten die Patienten rasch isoliert werden, noch bevor der für die definitive Diagnose erforderliche Virustest vorliege.
Der Algorithmus funktioniere so gut, weil viele Patienten mit Covid-19 charakteristische Veränderungen auf dem Lungenröntgenbild hätten, schreiben die Forscher. So sei das Lungengewebe oft beidseitig mit Flüssigkeit gefüllt und entzündet.
Ebenso wahr ist allerdings, dass die radiologischen Veränderungen nicht spezifisch sind für eine Infektion mit Sars-CoV-2. Das bedeutet, dass die Trefferquote der Maschine auch davon abhängen dürfte, wie häufig die Krankheit in der Bevölkerung auftritt. Inmitten einer Pandemiewelle, wo viele Lungenentzündungen auf das Konto des neuen Coronavirus gehen, wird die Genauigkeit höher sein als in Zeiten mit wenig Covid-19-Fällen. Kommt dazu, dass jede Röntgenaufnahme mit einer gewissen Strahlenbelastung einhergeht. Das gilt es zu berücksichtigen, bevor bei allen Spitalpatienten Röntgenbilder angefertigt werden.
24. November: Sars-CoV-2 passt sich in Nerzen an
kus. · Dass auch Nerze für Sars-CoV-2 empfänglich sind, hat in Dänemark zur Aussetzung einer ganzen Branche geführt: Das Land hat die Zucht der Pelztiere pausiert, Millionen der Marder wurden gekeult. Der Grund war eine genetische Veränderung von Sars-CoV-2, die nach Einschätzung von Fachleuten das Potenzial hatte, die Wirksamkeit der zurzeit in der Testung befindlichen Impfungen zu beeinträchtigen. Diese Version ist allerdings laut Fachleuten seit Mitte September nicht mehr nachgewiesen worden und dürfte ausgestorben sein.
Nun haben Forscher knapp 240 aus Nerzen gewonnene Viren auf genetische Veränderungen (Mutationen) hin analysiert und mit aus Menschen bekannten Sars-CoV-2-Erbgutsequenzen verglichen. Die weitaus meisten der Nerzsequenzen stammten von niederländischen Pelztierfarmen, wenige aus Dänemark. Sie repräsentieren sieben verschiedene Sars-CoV-2-Linien, wie die Forscher um François Balloux vom University College London in der Fachzeitschrift «Nature Communications» berichten. Die Analyse deute darauf hin, dass die Viren jeweils von Menschen in die verschiedenen Farmen eingetragen worden seien.
Sie identifizierten 23 Mutationen, die mindestens zweimal unabhängig voneinander in den Nerzen entstanden waren. Drei davon betreffen das Spike-Protein, mit dem das Virus an die Zelle andockt – und zwei davon waren je fünfmal neu entstanden, eine viermal. Dieselben Veränderungen fanden die Forscher auch in menschlichen Viren, die in verschiedenen Ländern (darunter auch die Schweiz) isoliert wurden. Bei einem Teil dieser Funde könne es sich zwar um Viren handeln, die von den Nerzen wieder in den Menschen zurückgesprungen seien, aber die Mutationen kämen auch zufällig in menschlichen Viren vor – aber sehr viel seltener als bei den Nerzen.
Dies deutet darauf hin, dass die beobachteten, wiederholt auftretenden Veränderungen dem Virus erlauben, sich besser an seinen neuen Wirt – den Nerz – anzupassen. Diese Anpassung zu beobachten, könne dabei helfen, zu verstehen, wie Viren den Sprung auf einen neuen Wirt meistern würden, so die Forscher. Für den Menschen dürften diese Veränderungen keine grosse Rolle spielen, sagt Balloux. Da sie es nie geschafft hätten, häufiger zu werden oder sich gar durchzusetzen, sei nicht auszuschliessen, dass sie dem Virus im Menschen womöglich sogar schadeten.
Interessant ist, dass diese Anpassungsphase bei Sars-CoV-2 im Menschen nicht beobachtet wurde. Das Virus gewinnt zwar an Diversität – was die These stützt, dass es ganz zu Anfang der Pandemie tatsächlich (von einem noch immer unbekannten Tier) nur einmal auf den Menschen übergesprungen ist –, aber es verändert sich nicht in der gerichteten Art, in der es das im Nerz tut, wie Balloux erklärt. Das erlaubt zwei Thesen: Möglicherweise war es beim Sprung in den Menschen schon so gut angepasst, dass das gar nicht mehr nötig war. Es funktioniere in einer ganzen Reihe von Säugetieren gut, sagt der Forscher. Oder aber es hatte die Anpassungsphase schon hinter sich, als die ersten Genome sequenziert wurden. Man gehe davon aus, dass es etwa Mitte Oktober übergesprungen sei, sagt Balloux. Die ersten Sequenzen hatte man erst Monate später.
20. November: WHO spricht sich gegen Remdesivir-Behandlung aus
slz. Eine von der Weltgesundheitsorganisation einberufene Expertengruppe hat sich nun offiziell gegen eine Therapie mit dem Mittel Remdesivir gegen Covid-19 ausgesprochen. Das Gremium aus Ärzten, Forschern sowie genesenen Covid-19-Patienten kam zu dem Schluss, dass es keine Hinweise dafür gebe, dass die Substanz die Todesrate senke, die Krankheitsdauer, die Intubationszeit oder den Spitalaufenthalt verkürze. Ihre Einschätzung erschien am Freitag im «British Medical Journal».
Möglicherweise gebe es kleine positive Effekte bei manchen Gruppen von Patienten, schreiben die Autoren. Allerdings könne man diese zurzeit nicht klar definieren. In Anbetracht der Kosten – bis zu 2000 Euro beziehungsweise gut 3000 Dollar für die von der Herstellerfirma Gilead vorgeschriebene einwöchige Remdesivir-Therapie – empfehle man keine grossflächige Anwendung, bevor nicht handfeste Beweise für eine Wirksamkeit vorlägen.
Die Einschätzung kommt nicht überraschend. Bereits Mitte Oktober hatte der von der WHO durchgeführte Solidarity Trial keine Wirksamkeit von Remdesivir bei mittel oder schwer erkrankten Covid-19-Patienten ergeben. Gilead hatte der Studie umgehend jegliche Qualität und Aussagekraft abgesprochen und auf eigene, allerdings kleineren Studien verwiesen. Experten bemängelten in den vergangenen Monaten immer wieder, dass Gilead insgesamt zu wenig Daten, beispielsweise auch zur Unterdrückung der Sars-CoV-2-Vermehrung, präsentiert habe. Trotzdem erhielt das Medikament im Sommer eine Notfallzulassung sowohl von der amerikanischen als auch von der europäischen Arzneimittelbehörde.
Remdesivir könnte das nächste Tamiflu werden, befürchten nun Wissenschafter. Das basierend auf Vorarbeiten eines Gilead-Forschers von der Schweizer Firma Hoffmann-La Roche produzierte Grippemittel wurde durch unvollständig publizierte Studiendaten, geschickte PR-Massnahmen und teilweise unter Irreführung von Behörden und Fachzeitschriften zu einem Verkaufsschlager. Erst 2012 konnte eine unabhängige Analyse der Cochrane Collaboration zeigen, dass das Produkt die Dauer einer Grippe nur um einen Tag verkürzt.
16. November: Moderna-Impfstoff soll hohe Wirksamkeit haben
(dpa) Mit dem US-Pharmakonzern Moderna hat ein weiterer für Europa relevanter Hersteller massgebliche Daten für seinen Corona-Impfstoff vorgelegt. Der RNA-Impfstoff habe eine Wirksamkeit von 94,5 Prozent, hiess es in einer Mitteilung von Moderna am Montag. Die Schweiz hat sich bereits im August 4,5 Millionen Dosen dieses Impfstoffs gesichert. Und die EU-Kommission verhandelt mit dem Konzern über die Lieferung von bis zu 160 Millionen Impfdosen. Am vergangenen Montag hatten das deutsche Unternehmen Biontech und der Pharmakonzern Pfizer bereits solche Zwischenergebnisse aus der entscheidenden Studienphase für ihren Impfstoff-Kandidaten vorgelegt.
16. November: Studie zur Wirkung von Echinaforce gegen Corona relativiert
(sda) Die Autoren der Echinaforce-Studie haben eine Korrektur im Fachmagazin «Virology» veröffentlicht. Sie weisen darauf hin, dass die antivirale Wirkung des Präparats gegen Coronaviren nur in der Petrischale nachgewiesen wurde. Um verlässliche Aussagen für Menschen zu treffen, seien klinische Studien nötig.
Im Herbst entstand ein regelrechter Wirbel um das Naturheilprodukt Echinaforce der Thurgauer Firma A. Vogel. Das Unternehmen publizierte gemeinsam mit dem Labor Spiez eine Studie, gemäss der Echinaforce im Reagenzglas eine abtötende Wirkung auf die Coronaviren hat. Medien berichteten, dass nach Bekanntwerden der Studie in Apotheken die Nachfrage nach dem Präparat stark gestiegen sei. Nun relativieren die Autoren im Fachmagazin «Virology» ihre ursprüngliche Studie, wie mehrere Medien am Montag berichteten. Für eine virenabtötende Wirkung des Produkts sei ein direkter Kontakt mit Viruspartikeln erforderlich. Da Echinaforce oral eingenommen werde, sei derzeit unklar, wie relevant dies «in vivo» sei.
16. November: Johnson & Johnson startet weitere Spätstudie mit Corona-Impfstoff
(Reuters) Der amerikanische Pharmakonzern Johnson & Johnson hat in Grossbritannien eine neue Spätstudie für seinen experimentellen Corona-Impfstoff Ad26COV2 begonnen.
Probanden erhielten entweder zwei Dosen des Impfstoffs oder ein Placebo in einem Abstand von 57 Tagen, sagte Saul Faust, Professor für pädiatrische Immunologie und Infektionskrankheiten, der die Studie am Universitätsklinikum Southampton mit leitet.
Johnson & Johnson nutzt ein Erkältungsvirus, um genetisches Material des Sars-CoV-2-Virus in den Körper zu schleusen und eine Immunantwort auszulösen. Die Plattform namens AdVac wird auch in einem Ebola-Impfstoff verwendet, der Anfang dieses Jahres zugelassen wurde. Parallel forscht das Unternehmen mit 60 000 Testpersonen, ob auch eine einzelne Impfdosis ausreichend Schutz gegen eine Infektion bietet.
14. November: Ein Inhalationsspray bessert Covid-19-Symptome
slz. Ein Immunstimulator, verabreicht einmal täglich als Inhalationsspray, könnte eine weitere Waffe im Kampf gegen eine Covid-19-Erkrankung werden. Dies legt eine kleine Studie mit 101 Patienten nahe, durchgeführt an neun britischen Spitälern. Die 14-tägige Therapie habe bei den Behandelten im Vergleich zur Placebogruppe das Risiko, einen schweren Verlauf von Covid-19 zu erleiden, um 79 Prozent reduziert, schreiben die Autoren in der Fachzeitschrift «The Lancet Respiratory Medicine». Vier Wochen nach der ersten Inhalation wiesen die Behandelten eine dreifach höhere Chance auf eine Verbesserung ihrer Symptome auf.
Der im Spray enthaltene Wirkstoff Interferon-Beta regt das unspezifische Immunsystem an, aktiv gegen Viren vorzugehen. Daher ist er schon länger ein Kandidat für eine Covid-19-Therapie. Doch erst vor wenigen Wochen ergab der von der Weltgesundheitsorganisation geleitete «Solidarity Trial» keine Verbesserungen durch Interferoninjektionen bei Covid-19-Patienten.
Es komme eben auf die Verabreichungsform an, sind die britischen Wissenschafter überzeugt. Bei einer Inhalation gelange nämlich der Wirkstoff direkt in die Lungen sowie auf die Schleimhäute im Rachen-Raum. Die Immunzellen werden im wahrsten Sinn des Wortes eingenebelt. So kann das Immunsystem schnell und vor allem gleich am Ort der Infektion starten. Virologen wie Mediziner erachten deshalb eine Spray- oder Inhalationstherapie mit antiviralen Mitteln seit längerem als sehr hilfreich gegen Covid-19.
Ein Wundermittel ist aber auch das Interferon-Spray nicht. Denn die Zeit bis zur Entlassung aus dem Spital wurde nicht signifikant gesenkt. Zudem kann man wegen der wenigen Probanden auch nicht sagen, ob das Spray die Sterblichkeit reduziert. Es gab drei Tote in der Placebogruppe und keinen bei den Behandelten, was aber statistisch nicht aussagekräftig ist. Man müsse nun unbedingt das Interferon-Spray in einer grösseren Phase-3-Studie testen, fordern die Autoren. Womöglich könnte es, bald nach einer Sars-CoV-2-Infektion verabreicht, auch die Schäden in der Lunge und damit Langzeitfolgen mindern.
11. November: Die FDA erteilt Notfallgenehmigung für eine Antikörper-Therapie
lsl. Am Montag teilte der Pharmakonzern Lilly mit, dass die FDA eine Notfallgenehmigung (Emergency Use Authorization) für das Medikament Bamlanivimab erlassen hat. Es handelt sich um eine Antikörper-Therapie. Der neutralisierende Antikörper kann das Immunsystem der Patienten bei der Beseitigung der Viren unterstützen. Auch bei Donald Trump soll dieser Ansatz geholfen haben. Die Zulassung der FDA beruht auf positiven Ergebnissen, die die Firma Anfang November in der Zeitschrift «New England Journal of Medicine» publiziert hat.
Das Medikament ist für die Behandlung von leichten bis mittleren Covid-19-Erkrankungen bei Personen mit einem hohen Risiko für schwere Verläufe zugelassen. Es muss früh genug verabreicht werden. Bei fortgeschrittener Erkrankung hat es sich als nicht wirksam und womöglich sogar schädlich erwiesen. Die Studie mit 450 Probanden zeigte, dass es eine Verschlechterung verhindern kann. Von den Patienten, die das Medikament erhielten, mussten nur 1,6 Prozent nachher im Spital behandelt werden, wohingegen es in der Placebogruppe 6,3 Prozent waren.
11. November: Die Massnahmen gegen Covid-19 schützen nur vorübergehend vor anderen respiratorischen Erkrankungen
Spe. · Die Massnahmen zur Kontrolle von Covid-19 haben einen positiven Nebeneffekt. Wer grössere Menschenansammlungen meidet, Abstand hält, Masken trägt und regelmässig die Hände wäscht, steckt sich auch seltener mit anderen Erregern an. Doch dieser positive Effekt ist möglicherweise nur vorübergehend. In der Fachzeitschrift «PNAS» weisen amerikanische Forscher auf die Gefahr hin, dass auf die verhinderten Ansteckungen ein umso grösserer Ausbruch folgen könnte.
Die Gruppe um die Erstautorin Rachel Baker von der Princeton University hat sich angeschaut, wie sich die im März 2020 verordneten Massnahmen auf das Infektionsgeschehen in verschiedenen amerikanischen Gliedstaaten ausgewirkt haben. Die Autoren konzentrierten sich dabei auf die saisonale Grippe und auf Infektionen mit dem Respiratorischen Synzytialvirus (RSV). Dieser Erreger befällt die Atemwege und kann vor allem bei Säuglingen und Kleinkindern schwere Symptome hervorrufen.
Obwohl die Massnahmen gegen Covid-19 zu einem Zeitpunkt in Kraft traten, als die Grippe- und RSV-Wellen bereits ihren saisonalen Höhepunkt überschritten hatten, konnten die Forscher danach einen deutlich schnelleren Rückgang der Fallzahlen als in den Vorjahren beobachten. Das steht im Einklang mit früheren Untersuchungen. Anschliessend untersuchten sie mit einem epidemiologischen Modell, wie sich die Kontrollmassnahmen auf die weitere Entwicklung auswirken. Dabei stellten sie fest, dass die Grippe- und RSV-Fallzahlen während der Kontrollperiode zwar tief bleiben, die Anfälligkeit der Bevölkerung aber mit der Zeit zunimmt. Das liegt daran, dass sich in der Bevölkerung keine Immunität aufbauen kann, wenn es kaum Infektionen gibt.
Die Folgen davon machen sich bemerkbar, wenn die Massnahmen aufgehoben werden. Im Modell geschah das nach 6 oder 12 Monaten. Das Modell sagt dann für die darauffolgende Wintersaison einen rasanten Anstieg der RSV-Fallzahlen voraus. Der Ausbruch ist dabei umso stärker, je länger die Kontrollmassnahmen beibehalten wurden. Für die saisonale Grippe sehen die Forscher einen ähnlichen Trend, allerdings seien die Unsicherheiten hier grösser.
10. November: Kreuzreaktive Antikörper erkennen Sars-CoV-2 und sind häufiger bei Kindern
lsl.· Es ist immer wieder die Rede von Kreuzimmunität im Zusammenhang mit verschiedenen Coronaviren, gemeint ist damit, dass das Immunsystem das neue Sars-CoV-2 bekämpft, weil es schon Erfahrung mit anderen Corona-Erkältungsviren hat. Tatsächlich haben mehrere Studien gezeigt, dass gewisse Gedächtnis-Immunzellen (B- und T-Zellen) auch auf das neue Sars-CoV-2 reagieren und es eliminieren können. Nun zeigen Forscher in einer Publikation in «Science», dass einige Menschen auch kreuzreaktive Antikörper besitzen.
Die Forscher untersuchten das Blut von 300 Personen, die noch keinen Kontakt mit Sars-CoV-2 hatten. 5 Prozent verfügten über Antikörper, die an Sars-CoV-2 andockten. Allerdings war die Palette der gefundenen Antikörper sehr eingeschränkt, so waren darunter nur solche aus der Klasse IgG, und diese waren auch nur gegen eine Untereinheit des sogenannten Spike-Proteins gerichtet. Im Gegensatz dazu haben Covid-19-Patienten Antikörper aus verschiedenen Klassen, IgA, IgG und IgM, die jeweils gegen zwei verschiedene Untereinheiten dieses Proteins gerichtet sind.
Die kreuzreaktiven Antikörper bewiesen auch eine gewisse Wirkung. Sie waren imstande, eine Infektion von Zellen in einem Zellkulturtest zu verhindern. Allerdings waren sie dabei weniger effizient als die Antikörper von Covid-19-Patienten.
Kinder verfügten viel häufiger über solche kreuzreaktiven Antikörper (44 Prozent), wie eine Untersuchung an 50 Kindern im Alter von 1 bis 16 Jahren zeigte. Auch wenn man aus anderen Studien wisse, dass die Antikörper gegen Coronaviren nicht besonders langlebig seien und auch keinen absoluten Schutz gäben, so seien sie wahrscheinlich imstande, die Krankheit abzuschwächen, schreiben die Forscher. Das erkläre womöglich, warum milde Verläufe bei Kindern und Jugendlichen viel häufiger seien als bei Erwachsenen.
6. November: Sechsmal mehr Kinder infiziert, jede zweite Infektion asymptomatisch
lsl. · Forscher haben in einer Studie in Bayern bei 15 770 Kindern im Alter von 1 bis 18 Jahren nach Antikörpern in Blutproben gesucht. Laut ihren Ergebnissen haben sich sechsmal mehr Kinder mit dem Virus infiziert, als offizielle Zahlen vermuten liessen. Das Ergebnis passt zu Schätzungen, die davon ausgehen, dass in der ersten Welle etwa zehnmal mehr Menschen infiziert waren als offiziell gemeldet. Gemeldet waren in Bayern 156 Infektionen pro 100 000 Kinder und 468 pro 100 000 Erwachsene.
35 Prozent der Kinder, die mit einem positiv getesteten Familienmitglied zusammenlebten, wiesen Antikörper auf. Bei 47 positiv getesteten Kindern füllten die Eltern zusätzlich Fragebögen zur Gesundheit aus. 22 dieser Kinder (47 Prozent) sollen keine Krankheitssymptome gezeigt haben.
Die Forscher verwendeten ein Testverfahren, bei dem sie jeweils nach zwei verschiedenen Antikörpern gegen unterschiedliche Virusproteine suchten, dies, um die Zuverlässigkeit der Ergebnisse zu verbessern. Ihre Evaluation zeigte, dass der Test eine Spezifität von 100 Prozent erreicht: Keine einzige von 3887 negativen Blutproben (aus der Zeit von vor der Pandemie) war positiv. Die Sensitivität betrug 97,3 Prozent: 73 von 75 positiven Blutproben wurden erkannt. Das Paper ist bei Cell in einer vorläufigen Version erschienen.
5. November: Die Letalität von Covid-19 ist weltweit unterschiedlich, in der Schweiz liegt sie bei 0,75 Prozent
slz./lsl. · Die Letalität von Covid-19 gibt immer wieder Anlass zu Diskussionen. Es wurden weltweit erhebliche Unterschiede festgestellt. Die Bandbreite bei dieser sogenannten «infection fatality rate» (IFR) reicht von 0,21 bis zu 1,29 Prozent. Es sterben also zwischen zwei und dreizehn von tausend Infizierten.
Zwei Studien haben in den letzten Tagen neue Daten präsentiert. Auffällig sind die jeweils erheblichen Schwankungen zwischen weniger entwickelten und Industrieländern. So finden sich bei einem britisch-französischen Team am unteren Ende der Skala Kenya und Pakistan mit einer IFR von jeweils weniger als 0,2 Prozent. Den unerwünschten Spitzenplatz belegt Japan mit einer IFR von über 1 Prozent. Deutschland weist eine IFR von ungefähr 0,8 und die Schweiz einen Wert von 0,75 Prozent auf. Ein Team des Imperial College geht von einem IFR-Wert von 0,23 Prozent für ärmere und einem von bis zu 1,15 Prozent für reichere Länder aus. Als Grund für die erheblichen Unterschiede weisen die Autoren auf die unterschiedliche Altersverteilung in den Ländern hin.
Den ausführlichen Bericht finden Sie hier.
4. November: Wer dreckige Luft einatmet, stirbt eher an Covid-19
ni.
· Als in Norditalien zu Beginn der Pandemie auffallend viele Personen an Covid-19 starben, suchte man fieberhaft nach Erklärungen. Der hohe Altersdurchschnitt in der italienischen Bevölkerung galt schnell als Hauptgrund für die vielen Corona-Toten. Einige Forscher machten aber schon früh auf umweltbedingte Faktoren wie eine starke Luftverschmutzung aufmerksam. In der hochindustrialisierten Poebene zwischen Turin und Venedig ist dieses Problem besonders gross.
Dass dreckige Luft einen beträchtlichen Einfluss auf die Covid-19-Sterberate haben dürfte, zeigt nach früheren Untersuchungen nun auch eine grossangelegte Studie aus den USA. In die statistische Analyse flossen die Daten zur langjährigen Feinstaubbelastung in 3089 amerikanischen Bezirken (Countys) sowie die dort bis Ende Juni gezählten Covid-19-Todesfälle ein.
Wie die Public-Health-Expertin Francesca Dominici aus Boston und ihre Kollegen in der Fachzeitschrift «Science Advances» schreiben, konnten sie zwischen der regionalen Belastung mit kleinsten Luftpartikeln, deren Durchmesser unter 2,5 Mikrometern liegt (PM2,5), und dem Covid-19-Sterberisiko einen statistischen Zusammenhang nachweisen. Mehr noch: Die beiden Messgrössen sind laut den Forschern in einer dosisabhängigen Art und Weise verknüpft. So ging eine im langjährigen Mittel um 1 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft höhere PM2,5-Belastung mit einer durchschnittlich 11 Prozent höheren Sterberate einher.
Mit ihrer Korrelationsstudie können die Wissenschafter nicht beweisen, sondern nur vermuten, dass die Luftverschmutzung die tatsächliche Ursache für die erhöhte Sterberate in einem Bezirk ist. Denn es ist möglich, dass in Gebieten mit schlechter Luftqualität ältere und gebrechlichere Menschen leben als an Orten mit sauberer Luft. Auch der Alkoholkonsum und das Rauchverhalten können regional unterschiedlich sein, was die Sterberate ebenfalls beeinflussen kann. Gibt es solche erklärenden Faktoren, dann wäre die dreckige Luft nicht die Ursache, sondern lediglich ein Indikator für eine regional erhöhte Mortalität.
Trotz den methodischen Unzulänglichkeiten ihrer Arbeit sind die Bostoner Forscher überzeugt, dass ein erhöhter Feinstaubgehalt in der Luft die Gesundheit der Bevölkerung angreift und so das Sterberisiko nach einer Covid-19-Infektion in die Höhe treibt. Ihre Zuversicht basiert dabei auf zwei Tatsachen. Erstens haben sie in ihrer Analyse zwei Dutzend bekannte Einflussfaktoren für die Sterberate mitberücksichtigt: von der regionalen Bevölkerungsdichte und Demografie bis zu Unterschieden bei klimatischen Faktoren wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
Zweitens hat die Feinstaubforschung in den letzten Jahren mit unzähligen Studien aufgezeigt, dass eine erhöhte PM2,5-Exposition – sie gilt vielen Experten als Indikator für eine schlechte Luftqualität – die menschliche Lunge und das Herz-Kreislauf-System direkt schädigen kann. Die damit verbundenen Erkrankungen führen nicht selten zum vorzeitigen Tod. Nach verschiedenen Schätzungen sterben jährlich weltweit 3 bis 7 Millionen Menschen an den Folgen der Luftverschmutzung.
Die neuste Arbeit zur Feinstaubbelastung und Covid-19-Sterblichkeit ist Teil einer Serie, mit der Forscher untersuchen wollen, wie Pandemien durch globale Umweltbedingungen beeinflusst werden. Idealerweise würde man für eine solche Studie nicht nur aggregierte Daten auf Regionsebene verwenden, sondern auch detaillierte Gesundheitsinformationen von sehr vielen Menschen einfliessen lassen, schreiben zwei Wissenschafter in einem Begleitkommentar zur Studie. Dann könnte man auch Aussagen darüber machen, wie die regionale Feinstaubbelastung das individuelle Sterberisiko der Personen beeinflusst.
Auch ohne Daten auf individueller Ebene sei die Arbeit aber wertvoll, betonen die Kommentatoren. Politiker sollten die Studie als Grundlage nehmen, um zu entscheiden, in welchen Regionen die Luftqualität prioritär verbessert werden müsse.
2. November: Der Lockdown hat die Zunahme von Geschlechtskrankheiten nicht gebremst
kus.
· Bei einem so harten Lockdown, wie er in Italien während der ersten Corona-Welle im Frühjahr galt, würde man eines sicher nicht erwarten: einen Anstieg gewisser sexuell übertragener Krankheiten. Doch genau diesen Befund stellten Forscher am diesjährigen (virtuellen) Kongress der European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) vor.
Die Wissenschafter verglichen die Krankheitsmeldungen aus zwei Zentren für die Behandlung sexuell übertragener Infektionen in Mailand zwischen Mitte März und Mitte April im letzten und in diesem Jahr, während des Lockdowns, wie die EADV in einer Mitteilung schreibt. Wie sich dabei zeigte, nahm die Anzahl der Hilfesuchenden ab, und zwar um 37 Prozent. Vor allem Patienten, die nur zu Kontrollen kämen, dürften laut den Forschern auf Termine verzichtet haben.
Allerdings diagnostizierten die Mediziner an den Zentren mehr Fälle akuter bakterieller Infektionen. Die absoluten Zahlen der Patienten mit Gonorrhö (Tripper), sekundärer Syphilis und Mycoplasma genitalium nahmen 2020 im Vergleich zu 2019 zu. Seltener wurden die nicht akuten Erkrankungen wie etwa verschiedene Arten von Warzen.
Laut Marco Cusini von der Fondazione IRCCS Ca’ Grande Ospedale Maggiore Policlinico in Mailand zeigt dieses Resultat, wie wichtig es sei, solche Anlaufstellen auch während der Pandemie offen zu halten. Der Lockdown reduzierte risikoreiches sexuelles Verhalten offenbar nicht – was nicht nur den Erregern der untersuchten Krankheiten, sondern auch Sars-CoV-2 Gelegenheit gegeben haben dürfte, sich auszubreiten.
In Chicago stiegen laut «ID Week» im Lockdown die in den Notaufnahmen entdeckten akuten HIV-Fälle an. Dort wurden im Rahmen von Corona-Tests auch HIV-Tests angeboten. Wie es zu dem Anstieg kommt, ist unklar. Möglicherweise liessen sich Personen eher testen, wenn sie befürchteten, womöglich auch mit dem HI-Virus infiziert zu sein, heisst es. Vielleicht habe die Furcht vor Sars-CoV-2 aber auch Personen dazu motiviert, sich testen zu lassen, die sonst eher keine medizinische Hilfe in Anspruch nähmen.
29. Oktober: Eine neue Sars-CoV-2-Variante dominiert Europa
rtz.
· Forscher aus der Schweiz und Spanien haben eine neue Sars-CoV-2- Variante ausfindig gemacht, die sich in den letzten Monaten über weite Teile Europas verbreitet hat. Zwar gibt es bis jetzt keinerlei Hinweise darauf, dass diese Variante gefährlicher ist oder gar mehr Todesopfer fordert als die bis anhin bekannten. Die Ergebnisse der Forscher zeigen jedoch, dass die Verbreitung des Virus über Landesgrenzen hinweg mit den im Sommer in ganz Europa geltenden Reisebeschränkungen nicht effektiv eingedämmt werden konnte. Die Fachpublikation ist auf der Preprint-Plattform «medrxiv» frei zugänglich und noch nicht begutachtet.
Derzeit zirkulieren allein in Europa Hunderte verschiedener Varianten des neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2. Sie unterscheiden sich untereinander durch Mutationen im Virusgenom. Nicht alle Varianten können sich gleich gut in der Bevölkerung verbreiten; tatsächlich herrschen einige wenige vor, darunter die neue Variante mit dem Namen «20A.EU1». Diese sei im Sommer erstmals bei einem Superspreading-Event unter Arbeitern in der Landwirtschaft im Nordosten Spaniens aufgetaucht, mache inzwischen aber 90 Prozent der untersuchten Sequenzen aus Grossbritannien aus. Ausserdem gehören 60 Prozent der in Irland gefundenen Sequenzen und zwischen 30 und 40 Prozent der Sequenzen aus der Schweiz und den Niederlanden dieser Variante an. Darüber hinaus wurde die Variante in Frankreich, Belgien, Deutschland, Italien, Lettland, Norwegen und Schweden sowie in Hongkong und Neuseeland entdeckt. Im Ursprungsland Spanien macht 20A.EU1 derzeit 80 Prozent der untersuchten Sequenzen aus.
Die Forscher glauben, dass die massive Ausbreitung dieser einen Variante durch die im Sommer vergleichsweise lockeren Reisebeschränkungen und Massnahmen des Abstandhaltens erleichtert wurde. Die genetischen Analysen zeigten, dass die Virusvariante mehrfach in verschiedene Länder eingetragen wurde und sich anschliessend in der lokalen Bevölkerung verbreitete. Die Beobachtungen seien nicht allein mit dem gegenwärtig starken Anstieg der Infektionszahlen über ganz Europa hinweg erklärbar. Vielmehr müsse man davon ausgehen, dass die Variante 20A.EU1 trotz den gegebenen Reisebeschränkungen mehrfach Landesgrenzen überschreiten konnte.
Langanhaltende Grenzschliessungen und starke Einschränkungen der Reisetätigkeit seien weder machbar noch wünschenswert, so kommentiert Emma Hodcroft, eine der Autorinnen der Studie, die Ergebnisse in der Pressemitteilung der Universität Basel. Die Ausbreitungsdynamik der Variante 20A.EU1 mache jedoch deutlich, dass die im Sommer geltenden Massnahmen oft nicht ausgereicht hätten, um die Verbreitung des Virus einzudämmen. Insbesondere für Länder, denen es mit strengen Vorschriften gelungen sei, die Fallzahlen auf ein niedriges Niveau abzusenken, sei es essenziell, sich mit wirksameren Massnahmen gegen die erneute Eintragung des Virus durch Reisende zu schützen.
28. Oktober: Corona greift auch das Gehirn an
rtz.
· Wer eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus durchmacht, hat in der Zeit danach unter Umständen mit kognitiven Schwierigkeiten zu kämpfen. Dies haben Wissenschafter des Imperial College in London nun genauer untersucht. Gemäss der Studie schnitten Probanden mit nachgewiesener Sars-CoV-2-Infektion in einem standardisierten Intelligenztest schlechter ab als diejenigen, die keine Infektion durchgemacht hatten. Dabei korrelieren die Leistungseinbussen mit der Schwere der Erkrankung: je stärker die Symptome der durchgemachten Corona-Infektion, desto schwächer die Leistungen im Intelligenztest.
Über diese Studie berichtet Wissenschaftsredaktorin Stephanie Kusma hier detailliert.
27. Oktober: Wie lange verbleiben Antikörper gegen Sars-CoV-2 im Blut?
rtz./lsl. · Forscher des Imperial College London haben untersucht, welcher Anteil der Bevölkerung Antikörper gegen Sars-CoV-2 in sich trägt – und wie lange diese im Blut erhalten bleiben. Die Ergebnisse sind heute online publiziert, aber noch nicht durch unabhängige Wissenschafter begutachtet worden. 365 104 Erwachsene unterzogen sich dafür drei Antikörpertests, die jeweils im Abstand von etwa einem Monat durchgeführt wurden. Der erste Test fand jeweils Ende Juni statt, als in Grossbritannien die Einschränkungen des öffentlichen Lebens wieder gelockert wurden.
Laut Studienergebnissen wiesen Ende Juni noch 6 Prozent der Bevölkerung Antikörper gegen das neuartige Coronavirus auf. Dieser Wert sank im Verlauf der dreimonatigen Untersuchung aber auf 4,8 und schliesslich 4,4 Prozent – ein Rückgang von satten 26,5 Prozent. Diese Abnahme der Antikörper war in allen Altersgruppen zu sehen, allerdings nicht über alle Altersgruppen hinweg gleich stark ausgeprägt. So verzeichneten die Forscher bei den jüngsten Studienteilnehmern (18 bis 24 Jahre alt) einen vergleichsweise geringen Rückgang um 14,9 Prozent, während dieser in der ältesten Teilnehmergruppe (75 Jahre und älter) 39 Prozent betrug.
Die Einzigen, bei denen die Antikörper im Verlauf der drei Monate nicht abgebaut wurden, waren jene Studienteilnehmer, die im Gesundheitsbereich arbeiten. Ausserdem, schreiben die Forscher, sei der Abbau der Antikörper bei denjenigen am höchsten gewesen, die nicht wissentlich mit Sars-CoV-2 infiziert gewesen seien (minus 64 Prozent). Unter denjenigen, deren Infektion zuvor bereits durch einen positiven PCR-Test gezeigt worden war, fiel der Abbau mit minus 22,3 Prozent deutlich geringer aus.
Eine andere Studie, die soeben in «Nature Microbiology» erschienen ist, verglich die Menge und Persistenz aktiver Antikörper, die Patienten nach unterschiedlich schweren Erkrankungen gebildet hatten: Je schwerer die Personen erkrankten, desto effizienter war ihre Antikörperreaktion. Diese wurde in einer Zellkultur auf die Probe gestellt. Auch einige asymptomatische Personen entwickelten jedoch sehr starke Antikörperreaktionen.
Die Forscher untersuchten das Blut von 96 positiv auf Sars-CoV-2 Getesteten wiederholt über mehr als drei Monate nach dem Auftreten der ersten Symptome. Nach vierzig Tagen nahm die neutralisierende Wirkung der Antikörper langsam ab. Bei den Personen, die eine asymptomatische Sars-CoV-2-Infektion mit geringer Antikörperreaktion entwickelt hatten, war sie nicht mehr nachweisbar. Bei jenen mit einer starken Antwort, die meist auch schwere Krankheitsverläufe durchgemacht hatten, waren drei Monate später dagegen noch hohe Mengen neutralisierender Antikörper zu finden.
Noch ist nicht gut verstanden, wie viele verbleibende Antikörper es für einen effektiven Schutz vor einer Zweitinfektion braucht. Noch ist auch unzureichend geklärt, welche Rolle Gedächtniszellen bei der Immunität spielen. Bezüglich einer künftigen Impfung könne bei nachlassender Immunität eine regelmässige Auffrischung ratsam sein, spekulieren die Autoren.
23. Oktober: Körpereigene Hilfe für Sars-CoV-2
kus. · Um eine Zelle zu infizieren, muss das neue Coronavirus Sars-CoV-2 an einen Rezeptor namens ACE2 andocken, der sich auf der Zelloberfläche befindet. Zudem müssen bestimmte körpereigene Enzyme, sogenannte Proteasen, das Spike-Protein des Virus aktivieren, indem sie es in seine zwei Untereinheiten zerschneiden. Dies reicht zur Infektion einer Zelle. Doch nun haben Forscher der Technischen Universität München (TUM) ein neues Protein identifiziert, das dem Virus seine Arbeit erleichtert, wie sie in der Fachzeitschrift «Science» beschreiben.
Der sogenannte Neuropilin-Rezeptor (NRP1) dient verschiedenen Viren bei der Infektion von Zellen. Mikael Simons von der TUM und seine Kollegen wollten deshalb herausfinden, ob er möglicherweise auch bei der Infektion mit Sars-CoV-2 eine Rolle spielt. Sie bauten deshalb verschiedene Kombinationen von ACE2, einer Protease und NRP1 in Zellen ein und brachten diese dann mit dem Virus in Kontakt. Wie sich erwartungsgemäss zeigte, reichte die Anwesenheit von ACE2 und der Protease für die Infektion. Zellen, die nur NRP1 auf ihrer Oberfläche trugen, liessen sich dagegen nicht infizieren.
War NRP1 jedoch zusätzlich zu ACE2 auf der Zelloberfläche vorhanden, förderte dies die Infektion deutlich, wie Simons berichtet. Der Rezeptor, der im Gegensatz zu ACE2 in grossen Mengen vorkomme, diene offenbar bei der Infektion als sogenannter Co-Faktor. Wie genau er die Infektion erleichtere, sei unklar – möglicherweise fange der NRP1-Rezeptor das Virus ein und lenke es zum ACE2-Rezeptor hin. Blockierten die Forscher NRP1, sei das Virus etwa 40 Prozent weniger infektiös gewesen.
Bis anhin sei die Entdeckung primär für das Verständnis des Virus wichtig, sagt Simons. Aber möglicherweise sei es auch als Ansatzpunkt für Therapien denkbar. Diese müssten dann allerdings zu einem sehr frühen Zeitpunkt stattfinden, wenn das Virus noch nicht weit im Körper verbreitet sei.
15. Oktober: Erste Pandemiewelle – in welchem Land gab es wie viele Tote?
ni. · Forscher des Imperial College in Grossbritannien haben berechnet, dass die erste Welle der Corona-Pandemie in England und Italien besonders viele Todesopfer gefordert hat. Für ihre in der Fachzeitschrift «Nature Medicine» erschienene Arbeit analysierten die Wissenschafter die sogenannte Übersterblichkeit in 19 europäischen Ländern sowie in Neuseeland und Australien. Bei dieser statistischen Methode wird die Zahl der aufgetretenen Todesfälle mit den – aufgrund der langjährigen Erfahrungen – erwarteten Werten verglichen. Sterben mehr Personen als erwartet, liegt derzeit die Vermutung nahe, dass dies der Pandemie geschuldet ist.
Die Forscher bezifferten die zusätzlichen, der Pandemie geschuldeten Todesfälle in den untersuchten Ländern auf total 206 000. Das entspricht etwa den jährlichen Lungenkrebstodesfällen in diesen Ländern. Allein in England und Wales forderte die Corona-Pandemie demnach zwischen Mitte Februar und Mai über 57 000 Todesopfer. In Italien waren es gut 48 000. Weitere Spitzenplätze auf dieser unrühmlichen Liste nehmen Spanien (>45 000) und Frankreich (>23 000) ein. Auch hoch sind die Werte in kleineren Ländern wie Belgien oder den Niederlanden (beide>8000). Die Schweiz nimmt mit 1400 zusätzlichen Todesfällen eine mittlere Position ein.
Die Sterblichkeit ist höher als erwartet
Statistisch erwartbare und tatsächlich eingetretene Todesfälle pro Woche bei Menschen über 65 Jahren in der Schweiz
Tatsächlich verzeichnete Todesfälle
Weitere starke Corona-Welle
Interessant ist, dass die Zahl der mit der Übersterblichkeitsstatistik errechneten zusätzlichen Todesfälle in den Ländern gesamthaft um 23 Prozent höher liegt als die Zahl der offiziell gemeldeten Corona-Todesfälle. Besonders gross ist der Unterschied in Spanien (+ 69 Prozent Tote in der Übersterblichkeit) und Italien (+ 46 Prozent). Die Gründe können nicht erkannte Covid-19-Fälle sein, aber auch eine höhere Sterblichkeit durch andere, wegen der Pandemie nicht optimal behandelte Krankheiten.
In einigen Ländern – darunter auch die Schweiz – ist die berechnete Übersterblichkeit dagegen geringer als die diagnostizierten Corona-Todesfälle. In wieder anderen Staaten wie Bulgarien, Australien oder Neuseeland lässt sich während der ersten Pandemiewelle sogar eine negative Übersterblichkeit – also eine Untersterblichkeit – nachweisen. Das könnte darauf hindeuten, dass in diesen Ländern die ergriffenen Corona-Massnahmen zu einer geringeren Zahl an Todesfällen durch andere Atemwegserkrankungen oder Verkehrs- und Freizeitunfälle geführt haben.
Die Forscher betonen, dass ihre Arbeit mit statistischen Unsicherheiten behaftet sei. Es sei zudem schwierig zu sagen, wie es zu den teilweise eklatanten Unterschieden in den Todesfallzahlen der einzelnen Länder gekommen sei. Dabei dürften verschiedene Faktoren wie der Gesundheitszustand der Bevölkerung, die sozialen Bedingungen, die Reaktion der Regierung sowie der Zustand des Gesundheitssystems eine Rolle gespielt haben.
12. Oktober: Welche Rolle die Übertragung über Aerosole in Büros und Klassenzimmern spielt
Spe. · Laut einem Modell besteht in geschlossenen Räumen ein erhebliches Risiko, sich über Aerosole mit dem Coronavirus anzustecken. Doch es gibt Möglichkeiten, sich zu schützen.
Es häufen sich die Hinweise, dass Aerosole möglicherweise mehr zur Übertragung des Coronavirus beitragen, als man bisher gedacht hat. Vor allem in geschlossenen Räumen besteht die Gefahr, dass die beim Sprechen oder Singen freigesetzten Schwebeteilchen eine Konzentration erreichen, die für eine Ansteckung genügt – und das, obwohl man Abstand zu potenziellen Virenträgern im Raum hält. Wie hoch das Infektionsrisiko ist, haben Forscher vom Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz nun mit einem einfachen Tabellenkalkulationsprogramm abgeschätzt. Das Fazit ihrer noch nicht begutachteten Arbeit lautet: Aerosole von hochinfektiösen Menschen können das Virus sehr effizient übertragen, es gibt aber Möglichkeiten, das Ansteckungsrisiko zu reduzieren.
Aerosole im Raum
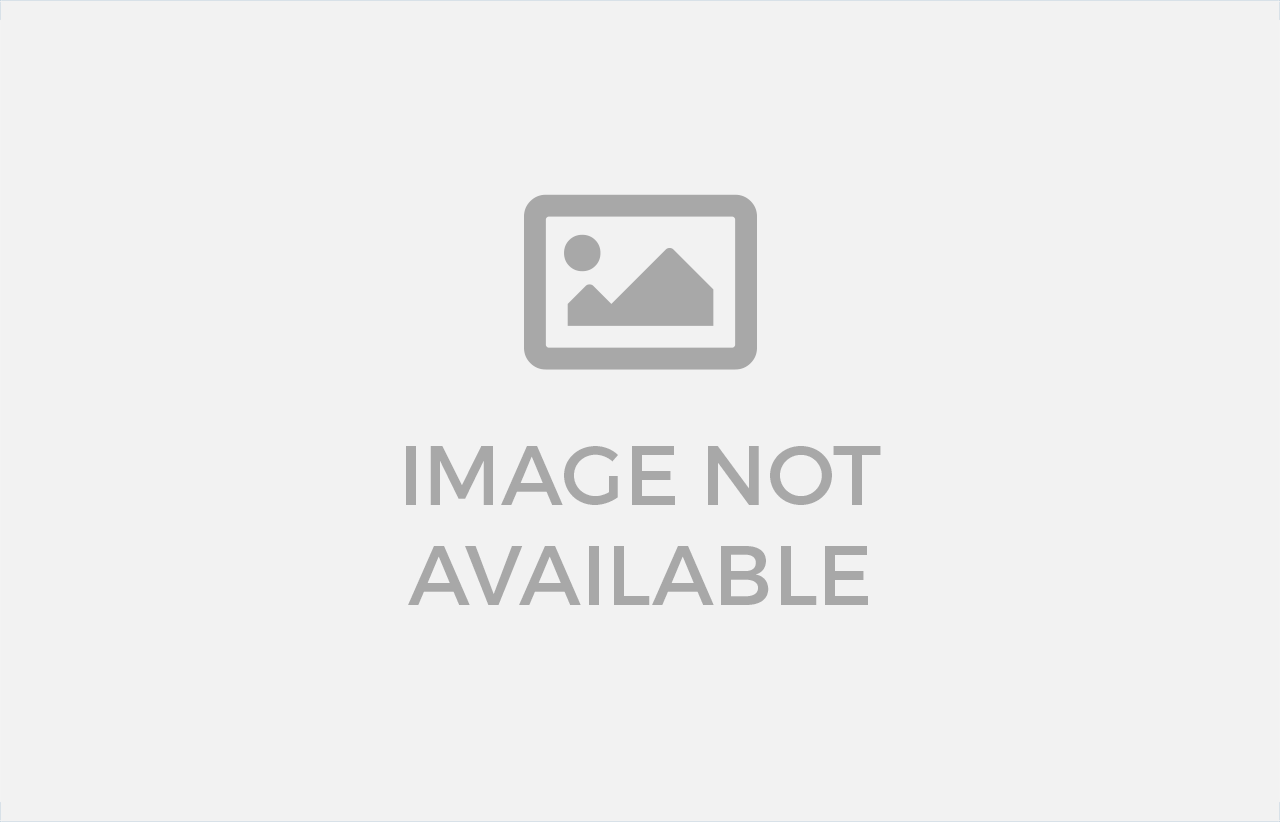
Wie jedes Modell beruht auch das Modell der Mainzer Forscher auf gewissen Annahmen. So hängt das Infektionsrisiko davon ab, wie viele Aerosole ein Infizierter beim Sprechen oder Singen ausstösst, wie hoch die Virenkonzentration in den Aerosolen ist, wie lange die Viren dort überleben und welche Virendosis für eine Ansteckung nötig ist. Diese und andere Parameter haben die Forscher anhand der wissenschaftlichen Literatur eingegrenzt und dann verschiedene Szenarien modelliert.
In einem der Szenarien teilt sich eine noch symptomfreie, aber bereits hochinfektiöse Person mit drei Berufskollegen einen 40 Quadratmeter grossen Büroraum. Laut dem Modell besteht bei jedem Kollegen ein individuelles Risiko von 18 Prozent, sich innerhalb von zwei Tagen anzustecken (danach treten in der Regel die Symptome auf, und der Infizierte begibt sich in Selbstisolation). Dieses Risiko halbiert sich, wenn der Raum regelmässig gelüftet wird. Noch besseren Schutz bietet das Tragen einer Maske. In diesem Fall reduziert sich das Ansteckungsrisiko je nach Qualität der Maske um den Faktor 8 bis 40. Ähnlich wirksam ist eine Belüftungsanlage mit Partikelfilter.
Besonderes Augenmerk gilt gegenwärtig dem Ansteckungsrisiko in Schulklassen. Zwar erkranken Schüler viel seltener und weniger heftig an Covid-19 als ältere Menschen. Sie können sich aber beim Lehrer oder bei Mitschülern anstecken und das Virus weitergeben. In einem 60 Quadratmeter grossen Schulzimmer mit 24 Schülern liegt das individuelle Ansteckungsrisiko laut dem Modell bei unter 10 Prozent. Wie im ersten Szenario lässt es sich erheblich verringern, wenn alle Schüler Masken tragen und das Schulzimmer regelmässig gelüftet wird.
Am schlechtesten kommen in der Untersuchung Chöre weg. Da ein Infizierter beim Singen wesentlich mehr Aerosole ausstösst als beim Atmen oder Sprechen, ist das individuelle Ansteckungsrisiko mit 29 Prozent sehr hoch. Zudem sind Masken hier kaum eine Option. Besonders kritisch wird es, wenn sich unter den Sängern ein Superspreader mit einer aussergewöhnlich hohen Virenlast befindet. In einem geschlossenen Raum ohne Lüftung und Partikelfilter ist eine Ansteckung über Aerosole dann so gut wie unvermeidlich. Zum Beleg verweisen die Autoren auf ein Superspreader-Ereignis bei einer Chorprobe in den USA.
Die Autoren betonen in ihrer Publikation, dass diese Zahlen mit erheblichen Unsicherheiten behaftet sind. Dennoch sind sie davon überzeugt, dass ihre Schlussfolgerungen robust sind.
9. Oktober: Masken senken die Infektionsrate um bis zu 30 Prozent
slz. · Im Laufe der letzten Wochen hat sich die Vermutung erhärtet, dass Gesichtsmasken das Risiko einer Ansteckung mit Sars-CoV-2 erheblich senken können. Ein eindrückliches Beispiel für die Bedeutung der Masken hat nun vor wenigen Tagen eine Forschergruppe der Simon Fraser University in Burnaby bei Vancouver geliefert. Sie zeigt, dass in der kanadischen Provinz Ontario durch die Maskenpflicht in Innenräumen die Anzahl der wöchentlichen Neuinfektionen in den Sommermonaten um bis zu einen Drittel gesenkt wurde.
Die verschiedenen Gesichtsmasken
Schützt in erster Linie das Umfeld des Trägers. Grössere Tröpfchen werden zuverlässig zurückgehalten. Die Maske empfiehlt sich für all jene, die Kontakt zu besonders gefährdeten Personen haben und diese vor einer Infektion schützen wollen. Dies auch vor dem Hintergrund, dass etwa die Hälfte der Ansteckungen durch Personen erfolgt, die selbst noch keine Symptome entwickelt haben.
Die genaue Bestimmung sei möglich gewesen, weil die einzelnen Bezirke Ontarios die Maskenpflicht gestaffelt ab Anfang Juni umgesetzt hätten, betonte das Team um Stephanie Pamplona. Somit hatte man die für die Statistik nötigen Vergleichsgruppen aus Regionen mit und ohne Maskenpflicht. Diese galt für alle Innenräume, also öffentliche wie private Büros sowie Busse und Bahnen.
Bereits im Juni hatten deutsche Forscher eine ähnliche Reduktion der Infektionszahlen durch Masken im thüringischen Jena berechnet. Dort hatte man die Maskenpflicht knapp drei Wochen früher als in vielen anderen Städten Deutschlands eingeführt.
Die Beobachtungen aus der realen Welt werden unterstützt durch eine vor wenigen Tagen präsentierte amerikanische Studie, die anhand von mathematischen Modellen die Wirksamkeit von Masken bestimmt hat. Diese Studie ist noch nicht wissenschaftlich begutachtet worden. Die Wissenschafter um Joshua Schiffer zeigen darin auf, dass selbst nicht absolut dichte Masken – also auch solche aus Baumwollstoff, die derzeit viele Personen tragen – die Virusverbreitungerheblich reduzieren können. Wenn 75 Prozent der Menschen in 75 Prozent der Zeit eine solche nicht perfekte Maske trügen, würde die Reproduktionszahl auf den magischen Wert von 1 sinken. Dieser gilt als Ziel, damit die Pandemie nicht ausser Kontrolle gerät. Würden alle Menschen den ganzen Tag lang eine Gesichtsmaske tragen, würde der R-Wert sogar unter 1 sinken. Damit wäre die Pandemie beherrschbar.
Die Autoren sind sogar davon überzeugt, dass Gesichtsmasken als Mittel der Prävention antiviralen, also Sars-CoV-2-blockierenden Substanzen überlegen sind. Denn solche Mittel nehme man ja erst dann ein, wenn bereits erste Symptome einer Infektion aufgetreten seien, sagen sie. Doch zu diesem Zeitpunkt kann ein Infizierter bereits mehrere Mitmenschen angesteckt haben. Dann helfen die Mittel – die notabene erst noch entwickelt werden müssen – vor allem dem Infizierten, weil sie dessen Viruslast senken und damit vermutlich die Schwere der Erkrankung mindern. Aber die Virusausbreitung in der Bevölkerung würden sie praktisch nicht stoppen.
28. September: Fehlgeleitete Antikörper und genetische Defekte als Risikofaktoren
slz. Noch immer grübeln Forscher und Ärzte darüber, warum manche Sars-CoV-2-Infizierte eine schwere Covid-19-Erkrankung entwickeln und andere mit Husten und Halsschmerzen davonkommen. Nun hat ein internationales Forscherteam fehlgeleitete Antikörper sowie genetische Defekte als weitere Risikofaktoren identifiziert. Die Studien wurden im Fachmagazin «Science» publiziert.

Eigentlich ist die Aufgabe von Antikörpern, Viren und andere Eindringlinge unschädlich zu machen. Doch es gibt auch einige wenige Antikörper, die aufs falsche Ziel losgehen und dann mehr schaden als nützen. Erkrankungen wie Diabetes Typ 1 oder rheumatoide Arthritis können die Folge sein. Und offenbar auch eine entgleiste Sars-CoV-2-Infektion.
Ein internationales Forscherteam hat bei rund 10 Prozent von knapp 1000 untersuchten Patienten mit einer schweren Covid-19-Erkrankung Antikörper gefunden, die Proteine des Immunsystems namens Interferon alpha blockieren. Genau diese sind aber dafür zuständig, dass die erste Verteidigungslinie gegen Sars-CoV-2 aktiviert wird. Sie stoppen die Eiweissbildung in den Zellen und veranlassen, dass virale Erbgutstücke abgebaut werden. Somit können in bereits befallenen Zellen keine neuen Viren mehr gebildet werden, und die Infektion wird deutlich verlangsamt. Es gibt verschiedene Varianten der Alpha-Interferone. Sie werden von Immunzellen gebildet, wenn diese Viren entdeckt haben.
Fehlen die Alpha-Interferone, können sich die Viren ausbreiten und weitere Zellen infizieren. Somit kann sich eine Sars-CoV-2-Infektion innert weniger Tage zu einer schweren Covid-19-Erkrankung entwickeln. Man habe Hinweise, dass die Anti-Interferon-alpha-Antikörper bereits vor einer Sars-CoV-2-Infektion vorhanden seien, schreiben die Forscher. Die Betroffenen bemerkten das meist aber nicht. Bis anhin habe man keine Daten darüber, ob die Betroffenen auch von anderen viralen Erkrankungen schwerer betroffen seien.
Wie wichtig die Anwesenheit von Interferon alpha für die Bekämpfung von Sars-CoV-2- ist, zeigte sich auch bei anderen Patienten der erwähnten Gruppe. Personen, die aufgrund genetischer Defekte keine Alpha-Interferone bilden können, erkranken ebenfalls schwer an Covid-19.
Die neuen Erkenntnisse könnten auch erklären, warum ältere Menschen und Männer häufiger schwere Verläufe entwickeln als Jüngere und Frauen: In der untersuchten Patientengruppe habe die Menge der fehlgeleiteten Antikörper im Alter zugenommen, schreiben die Autoren. Zudem hätten deutlich mehr Männer als Frauen solche Anti-Interferon-alpha-Antikörper.
Die Studien geben auch neue Handlungsempfehlungen für die Therapie: So könnten eine Blutwäsche und die Entfernung der fehlgeleiteten Antikörper den Zustand der Betroffenen verbessern, schreiben die Forscher. Auch könnte die Gabe von Interferon beta, das ähnliche Effekte hat wie sein Namensvetter, das geschwächte Immunsystem unterstützen. Hingegen sollten Patienten mit Mutationen in den Genen für die Interferon-alpha-Varianten das Protein als Medikament erhalten, und zwar möglichst früh nach einer Infektion mit Sars-CoV-2. Allerdings müsste man dafür erst herausfinden, bei wem ein solcher Gendefekt vorliegt.
24. September: Weniger Grippefälle während der Corona-Pandemie
kus. · Im Winter ist Grippesaison auf der Nordhalbkugel; im Süden grassiert die Krankheit gewöhnlich während unserer Sommermonate. In diesem Jahr allerdings überschnitt sich die Grippesaison mit der Corona-Pandemie – im Norden zum Teil, im Süden ganz. Amerikanische Forscher haben nun die Folgen dieser Überschneidung für die Influenza-Aktivität in den USA, Australien, Südafrika und Chile untersucht.

Sie registrierten in den USA kurz nach Beginn der gesellschaftlichen Massnahmen zur Eindämmung von Sars-CoV-2 – wie etwa Schulschliessungen, Gebrauch von Masken oder Social Distancing – einen deutlichen Rückgang der positiven Influenza-Tests in den USA: Vor Einführung der Massnahmen fanden die Labors das Influenzavirus in 20 Prozent der eingereichten Proben, kurze Zeit später nur noch in knapp über 2 Prozent.
Dies könne daran liegen, dass die Grippesaison zu dieser Zeit Ende März bereits ihrem Ende entgegengegangen sei, schreiben die Forscher im «Morbidity and Mortality Weekly Report» der Gesundheitsbehörde und der Centers for Disease Control and Prevention in den USA. Allerdings sei der Rückgang sehr drastisch, was dafür spreche, dass hier andere Faktoren eine Rolle spielten. Über die Sommermonate sei die Influenza-Aktivität mit 0,2 Prozent positiven Proben dann im Vergleich zu den vorherigen Jahren (1 bis 2 Prozent) auf einem historisch niedrigen Niveau geblieben.
Auf der Südhalbkugel wiederum fand die jährliche saisonale Influenza-Epidemie laut den Forschern gar nicht erst wirklich statt: Das Virus habe dort praktisch nicht zirkuliert. In Australien beispielsweise sei das Influenzavirus in über 60 000 Proben 33 Mal gefunden worden. In den drei untersuchten Ländern der Südhalbkugel zusammen seien zwischen April und Juli 2020 insgesamt 51 von über 83 000 untersuchten Proben positiv gewesen.
Diese ökologische Analyse zeige jedoch keine Kausalität auf, schreiben die Forscher; sie könne nicht belegen, dass die gegen Sars-CoV-2 gerichteten Massnahmen auch die Influenzaviren eindämmten. Zudem gebe es noch weitere Faktoren, die bei der reduzierten Influenza-Aktivität eine Rolle spielen könnten. Die Konsistenz der Resultate über verschiedene Länder hinweg sei aber fesselnd.
Die Forscher betonen allerdings, dass angesichts der Unsicherheiten, was die Entwicklung der Pandemie und die gegen sie ergriffenen Massnahmen angehe, eine gute Vorbereitung auf die nächste Grippesaison wichtig sei. Sie raten zur Impfung, die weiterhin die beste Vorsorge gegen die Influenza darstelle.
22. September: Das Tragen einer Brille könnte das Risiko einer Infektion mit Sars-CoV-2 senken
kus. · Brillen können mühsam sein. Bei Sonnenschein können ihre Träger nicht einfach zu irgendeiner Sonnenbrille greifen, bei Regen stören die Tropfen, und die Gläser laufen auch noch gerne an. Doch nun deutet eine kleine Pilotstudie aus China auf einen potenziellen Nutzen von Brillen hin, der über klare Sicht und Mode hinausgeht: Möglicherweise kann das Tragen einer Brille das Risiko einer Ansteckung mit Sars-CoV-2 senken. Darauf zumindest deuten die Daten einer kürzlich in der amerikanischen Fachzeitschrift «JAMA Ophthalmology» veröffentlichten Beobachtungsstudie hin.
Die Wissenschafter untersuchten, wie viele von knapp 280 wegen Covid-19 in Suizhou, China, ins Spital eingewiesenen Patienten mindestens acht Stunden am Tag eine Brille trugen. Es waren 16 Personen – knapp 6 Prozent der Probanden –, und alle waren kurzsichtig. Diese Zahl verglichen die Wissenschafter dann mit Daten zur Kurzsichtigkeit aus der Bevölkerung. Dabei griffen sie auf eine Untersuchung aus dem Jahr 1985 zurück, in der die Fehlsichtigkeit unter Studenten erhoben worden war. Damals waren gut 31 Prozent der Probanden kurzsichtig – Personen, deren Alter heute etwa dem Median der untersuchten Covid-19-Patienten entspricht, wie die Wissenschafter schreiben.
Mit knapp 6 Prozent war der Anteil der Personen, die ihre Brille täglich für längere Zeit trugen, unter den Covid-19-Patienten kleiner als unter der Allgemeinbevölkerung. Dies lege nahe, dass das tägliche Brillentragen mit einem geringeren Risiko einer Infektion mit Sars-CoV-2 verknüpft sei, folgern die Forscher. Möglicherweise fassten sich Brillenträger seltener an die Augen, spekulieren sie; aber zumindest deute das Ergebnis darauf hin, dass die Augen ein wichtiger Infektionsweg sein könnten.
Die Forscher melden allerdings gleich selbst verschiedene Einschränkungen ihrer Studie an: die kleine Zahl an Probanden (die zudem an nur einem Zentrum gesammelt wurde), die älteren Daten, auf die sie zurückgriffen, und dass die Kurzsichtigen in der Bevölkerung nicht alle Brillen tragen. Auch die Rolle von Kontaktlinsen habe ihre Untersuchung nicht geklärt. Es brauche nun weitere, grössere Studien, um diese Punkte sowie allfällige Gründe zu untersuchen, warum Brillen schützen könnten.
15. September: Weitere Hinweise darauf, dass Rekonvaleszenten-Plasma den Verlauf von Covid-19 günstig beeinflussen kann
ni. · Bei einer neuen Infektionskrankheit ohne wirksame Behandlung ist es das übliche Prozedere: Ärzte verabreichen besonders schwer erkrankten Patienten das Plasma von Personen, die zuvor die Krankheit erfolgreich überwunden haben; deren Antikörper sollen dem Patienten bei der Bekämpfung der Infektion helfen. So ist es auch bei Covid-19 geschehen, wobei der Nutzen dieses sogenannten Rekonvaleszenten-Plasmas erst in kleineren Studien untersucht wurde. So konnten Forscher in China und Spanien bei Patienten mit schwerem Krankheitsverlauf eine leicht reduzierte Sterblichkeit nachweisen.
Ein ähnliches Bild zeigt auch eine neue Untersuchung aus dem Mount Sinai Hospital in New York in den USA. Auch hier dürfte der zwischen dem 24. März und dem 8. April eingesetzte Behandlungsansatz bei 39 Patienten mit schwerer oder lebensbedrohlicher Covid-19-Erkrankung von Nutzen gewesen sein. Der Konjunktiv ist angebracht, weil es sich bei der Studie um einen retrospektiven Vergleich mit einer Kontrollgruppe von 156 Patienten handelt, die ohne Rekonvaleszenten-Plasma behandelt worden waren. Bei diesem Studiendesign kann nie ganz ausgeschlossen werden, dass allfällige Unterschiede bei den Resultaten auf andere Gründe als die eingesetzte Therapie zurückzuführen sind.
Wie die Analyse zeigt, hatten die Patienten mit Rekonvaleszenten-Plasma nicht nur ein geringeres Risiko, 14 Tage nach der Transfusion Sauerstoff zu benötigen (18 Prozent), als Personen ohne diese Behandlung (28 Prozent). Sie starben auch seltener (13 Prozent gegenüber 24 Prozent). Wegen der geringen Fallzahlen ist die statistische Aussagekraft der Ergebnisse allerdings auch bei dieser Studie beschränkt. Es brauche daher grössere und randomisierte klinische Studien, fordern die Forscher.
9. September: Auch bei jungen Patienten machen starkes Übergewicht und Diabetes einen schweren Krankheitsverlauf wahrscheinlicher
rtz · Noch immer gilt Covid-19 als eine Krankheit, die vorab den Alten gefährlich wird. Doch stellen sich angesichts rapide ansteigender Infektionszahlen unter jungen Erwachsenen immer drängender die Fragen, wie häufig schwere Verläufe in dieser Altersgruppe zu erwarten sind und mit welchen Risikofaktoren diese verbunden sind. Genau dies haben Forscher um Scott Solomon vom Brigham and Women’s Hospital in Boston, Massachusetts, nun untersucht.
Für ihre Studie analysierten die Mediziner Daten von 3222 jungen Erwachsenen im Alter von 18 bis 34 Jahren, die in den Monaten April bis Juni 2020 nach einer bestätigten Corona-Infektion aus US-amerikanischen Spitälern entlassen wurden.
57,6 Prozent dieser Patienten waren männlich, 57 Prozent schwarz oder hispanisch. Die bekannten Risikofaktoren für eine schwere Covid-19-Erkrankung waren auch unter den jungen Patienten deutlich auszumachen: Mehr als jeder Dritte von ihnen war adipös (das heisst, ihr Body-Mass-Index lag über 30), ein knappes Viertel hatte sogar eine Adipositas Grad III. Von einer solchen spricht man, wenn der Body-Mass-Index (BMI) über 40 liegt. Etwa jeder fünfte Patient hatte Diabetes, jeder sechste Bluthochdruck.
21 Prozent dieser Patienten benötigten infolge der Infektion mit Sars-CoV-2 eine intensivmedizinische Behandlung, 10 Prozent wurden künstlich beatmet, für 2,7 Prozent endete die Covid-19 mit dem Tod. Starkes Übergewicht, Bluthochdruck und Diabetes erhöhten demnach auch für die Jungen die Gefahr eines schweren Infektionsverlaufs, insbesondere wenn zwei oder gleich alle drei dieser Risikofaktoren zusammenkämen, schliessen die Ärzte. Die Arbeit erscheint im Fachjournal «Jama Internal Medicine».
8. September: Mit lokalen Strategien lassen sich die Kosten für die Eindämmung des Virus minimieren
rtz · In den frühen Tagen der Coronavirus-Pandemie zehrten wir alle noch von der Hoffnung, dass die weltweit verhängten, strikten Lockdowns das Virus auslöschen würden. Diese Hoffnung hat sich seither zerschlagen. Seit Monaten bleiben die Fallzahlen stabil. Zwar bewegen sie sich auf einem relativ niedrigen Niveau, sind aber doch viel zu hoch, um Entwarnung zu geben. Lokale Ausbrüche machen immer wieder die Schliessung von Schulen, Bars oder Clubs notwendig.
In dieser Situation liegt der Gedanke nahe, dass das Virus mit weitaus geringfügigeren Einschnitten in das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben in Schach gehalten werden könnte, wenn Massnahmen wie Schliessungen und Lockdowns lokal oder regional begrenzt verhängt werden. Inwieweit dies zutrifft, haben nun Forscher aus Kanada untersucht. Insbesondere wollten sie das intuitiv einleuchtende Ergebnis, dass lokale Lockdowns «sparsamer» mit den ökonomischen Ressourcen umgehen, quantifizieren. Die Studie ist im Fachmagazin «PNAS» erschienen.
Die Wissenschafter modellieren darin das epidemische Geschehen in Kanada; die räumlichen und demografischen Daten sind also an die dortigen Gegebenheiten angelehnt: Weite, dünn besiedelte Landstriche wechseln sich mit intensiv genutzten Ballungszentren ab. Im ländlichen Raum, schreiben die Autoren, brächen Infektionsketten häufiger «von sich aus» ab, also ohne das rigorose Testen, Isolieren und Nachverfolgen von Kontakten, das inzwischen fast überall praktiziert wird. Das liege daran, dass dort Ansässige generell weniger Kontakte hätten, weniger beengt lebten und weniger reisten, schreiben die Forscher. Dies dürfte zum deutlichen Ergebnis der Studie beitragen: Im Idealfall führen lokale Massnahmen demnach zu 22 Prozent weniger «Ausfalltagen»; wobei die Forscher unter diesem Begriff sowohl Schulkinder, die einen Unterrichtstag verpassen, als auch Schliesstage von Geschäften aller Art subsumieren. Dafür lag bei der lokalen Strategie die Anzahl der infizierten Personen insgesamt um 1 Prozent höher.
Wie gross der Unterschied zwischen regionalen und überregionalen Massnahmen ist, hänge davon ab, bei welcher Quote von gegenwärtig Infizierten pro 100 000 Einwohnern bestimmte Massnahmen in Kraft träten. Sowohl bei sehr hohen als auch bei sehr niedrigen Schwellenwerten nähern sich die Effekte der regionalen und der überregionalen Strategie hinsichtlich der Anzahl infizierter Personen und der in Kauf zu nehmenden Schliesstage an.
Für das Funktionieren einer lokalen Strategie sei es indes wichtig, dass die Massnahmen und die Schwellenwerte, bei denen diese in Kraft treten, zwischen den verschiedenen Counties koordiniert würden, schreiben die Forscher. Auch dieser Zusammenhang ist aus den Simulationsergebnissen ablesbar: Gehen verschiedene Counties unterschiedlich streng mit Infektionsclustern und Ausbrüchen um, dann schmelzen die Vorteile der lokalen Schliessungen schnell dahin. Dies vor allem wegen der Reisetätigkeit, die im Modell der kanadischen Forscher nicht nennenswert eingeschränkt ist. Insofern bestätigen die Studienergebnisse aus Kanada, was auch europäische Epidemiologen schon im Frühsommer forderten: Es braucht eine einheitliche europäische Strategie zur Bekämpfung des Virus.
7. September: Ein Grossteil der von Sars-CoV-2 hervorgerufenen Veränderungen im Lungengewebe ist reversibel
(sda/dpa) Ein Team der Universitätsklinik in Innsbruck hat in einer Studie mit 86 Corona-Patienten festgestellt, dass ein Grossteil der durch die Krankheit ausgelösten Lungenveränderungen reversibel ist. 55 Prozent der hospitalisierten Covid-19-Patienten würden aber auch noch sechs Wochen nach der Krankenhausentlassung körperliche Beeinträchtigungen zeigen.

Im Rahmen der Studie seien erstmals die Langzeitfolgen von Covid-19 an stationär versorgten Patienten untersucht worden, teilte die Medizinische Universität Innsbruck am Montag mit. In die Studie eingeschlossen waren 86 Patienten – 70 Prozent davon Männer – zwischen 50 und 70 Jahren. Die Probanden waren im Schnitt übergewichtig bis adipös, 44 Prozent waren vormals Raucher und ein wesentlicher Teil litt unter Vorerkrankungen.
55 Prozent der hospitalisierten Covid-19-Patienten hätten auch sechs Wochen nach der Entlassung aus dem Krankenhaus anhaltende körperliche Beeinträchtigungen gezeigt, so die Studienautoren. An erster Stelle lag mit knapp 50 Prozent die Kurzatmigkeit bei Belastung, 15 Prozent klagten über andauernden Husten. Grundsätzlich hätten die Patienten eine überdurchschnittlich lange Genesungsphase beschrieben, die Intensität der Beschwerden hätte sich aber im Verlauf deutlich verbessert.
In CT-Untersuchungen sechs Wochen nach Krankenhausentlassung zeigten sich bei 88 Prozent der Patienten anhaltende leicht- bis mittelgradige strukturelle Veränderungen der Lunge. Diese bildeten sich allerdings im Zeitverlauf bei den meisten Patienten deutlich zurück. Derzeit gebe es keine Hinweise auf fortschreitende Lungenschäden. Ob die Veränderungen der Lunge vollständig abklingen, sei aktuell noch nicht zur Gänze zu beantworten.
3. September: Impfstoffkandidaten auf Basis der ersten bekannten Sars-CoV-2-Genome dürften alle jetzt kursierenden Covid-19-Erreger abdecken
kus. · Es ist kein Jahr her, dass das neue Coronavirus auf den Menschen übergesprungen ist. Mittlerweile hat Sars-CoV-2 Millionen Menschen infiziert; und ein grosser Teil der Hoffnung, seinen Siegeszug stoppen zu können, ruht auf Impfstoffen. Erste Impfstoffkandidaten sind bereits weit in ihrer Prüfung fortgeschritten. Nun haben Forscher untersucht, wie stark sich das Virus verändert und inwieweit dies die Wirksamkeit der Impfstoffe beeinträchtigen könnte.

Wie die Wissenschafter in der Fachzeitschrift «PNAS» beschreiben, verglichen sie dafür die Erbgutsequenzen von über 18 000 Covid-19-Erregern, die vom Beginn der Pandemie bis in die zweite Maihälfte hinein weltweit aus Patienten isoliert worden waren. Dabei fanden sie keine klare Differenzierung der Viren in Untergruppen oder Hinweise darauf, dass die globale Ausbreitung von bestimmten Fitness-Effekten getrieben ist – ein Ergebnis, das auch Richard Neher und seine Kollegen von der Universität Basel aus ihren Analysen ablesen.
Selbst die Ausbreitung der besonders gut untersuchten Mutation D614G, die in den allerfrühesten sequenzierten Viren fehlt, sich mittlerweile aber global in fast 70 Prozent der Erreger findet, könnte demnach auf Zufälle zurückgehen. Neben D614G konnten sich laut den Forschern nur zwei weitere Mutationen durchsetzen und kommen nun in einem Grossteil der Viren vor; eine davon ist mit D614G gekoppelt. Die andere liess sich aufgrund des Studiendesigns nicht nachweisen. D614G befindet sich zwar in einem für die Impfstoffentwicklung wichtigen Bereich des Virus-Genoms; die Veränderung hat laut verschiedenen Untersuchungen aber keinen Einfluss auf die Immunantwort.
Über das ganze Genom gesehen sind die Viren laut der Analyse sehr wenig divers und unterscheiden sich nur an wenigen Erbgutstellenvoneinander. Bis anhin stellten die kursierenden Sars-CoV-2 eine einzige Population dar, schliessen sie aus ihren Resultaten. Insgesamt gehen die Forscher daher davon aus, dass die bisherigen Impfstoffkandidaten die kursierenden Viren abdecken dürften.
30. August: Blutverdünnung kann das Sterberisiko bei hospitalisierten Covid-19-Patienten offenbar erheblich senken
kus. · Eine Therapie mit blutverdünnenden Medikamenten hat gemäss einer retrospektiven Untersuchung an 4400 wegen Covid-19 hospitalisierten Patienten das Risiko, im Spital zu sterben, um 50 Prozent gesenkt. Jenes einer Intubation reduzierte sich unter einer Blutverdünnung um 30 Prozent. Wurde die Therapie innert zwei Tagen nach der Einweisung ins Spital begonnen, machte es keinen signifikanten Unterschied, ob die Behandlung mit vorbeugenden oder therapeutischen Dosierungen der blutverdünnenden Medikamente erfolgte.

Die Wissenschafter um Valentin Fuster vom Mount Sinai Hospital in New York hatten für ihre Studie Daten von Patienten ausgewertet, die im März und im April mit bestätigten Sars-CoV-2-Infektionen in fünf New Yorker Spitäler eingewiesen worden waren. Die Patienten waren den einzelnen Therapie-Regimen also nicht wie in einer randomisierten Studie zufällig zugewiesen worden, sondern die Blutverdünnung war vom jeweils behandelnden Arzt im Rahmen der individuell angepassten Therapie veranlasst worden.
Dies könnte einen Teil des beobachteten, enorm grossen Effekts erklären: Bei randomisierten Studien, in denen Medikamente geprüft würden, sehe man Effekte dieser Grössenordnung praktisch nie, erklärt Nils Kucher von der Klinik für Angiologie des Universitätsspitals Zürich. «Hier ist er aber so gross, dass da sicher etwas dran ist. Das muss man nun mit randomisierten Studien nachprüfen.» Solche Untersuchungen liefen auch bereits, sagt der Mediziner.
Er selbst hat im Juni begonnen, Patienten für eine ähnliche Studie zu rekrutieren – allerdings nicht im Spital: Dort würden Covid-19-Patienten schon standardmässig mit Blutverdünnern behandelt. Stattdessen will Kucher prüfen, ob leichte Fälle, die zu Hause ausheilen können, von einer Blutverdünnung profitieren. Er sucht dafür über 50-jährige Personen, die positiv auf Sars-CoV-2 getestet sind, gewöhnlich keine Blutverdünnung brauchen und bei denen auch die Infektion nicht automatisch eine blutverdünnende Therapie nach sich zieht. Letzteres ist laut Kucher etwa bei Personen der Fall, die bereits einmal eine Thrombose hatten.
Zurzeit sei es noch zu früh, einfach allen Infizierten automatisch eine Blutverdünnung zu verordnen, sagt der Arzt. Dazu wisse man noch zu wenig über die Kosten-Nutzen-Abwägung. Tatsächlich beobachteten die Forscher in der neuen Untersuchung bei den höheren (therapeutischen) Dosierungen etwas häufiger schwere Blutungen. Dies deute darauf hin, dass Ärzte für jeden Patienten eine individuelle Risikoabwägung vornehmen sollten, heisst es denn auch in einer Mitteilung des Mount Sinai Hospital. Insgesamt seien schwere Blutungen aber selten gewesen, schreiben die Forscher in der Fachzeitschrift «Journal of the American College of Cardiology».
26. August: Unterschiede in der Immunantwort zwischen Männern und Frauen

slz.· Schon kurz nach Beginn der Sars-CoV-2-Pandemie wurde klar: Männer haben ein höheres Risiko, eine schwere Covid-19 zu entwickeln, als Frauen. Zudem sterben Männer öfter daran. Obwohl sich ungefähr gleich viele Frauen wie Männer infizierten, waren bisher je nach Land 50 bis 70 Prozent der Covid-19-Toten männlich. Als Ursache vermuten Experten ein unterschiedlich aktives Immunsystem der beiden Geschlechter. Männer kommen generell mit Viren oder auch anderen Erregern weniger gut klar, zumindest im Durchschnitt sind sie von vielen Infektionserkrankungen stärker betroffen.
Forscher der Yale University haben nun die Immunantwort gegen Sars-CoV-2 von 98 Männern und Frauen getrennt analysiert. Ein entscheidender Unterschied war die Aktivität der T-Zellen. Diese erkennen unter anderem von den Viren befallene Körperzellen und attackieren sie. Doch hier schwächelte das männliche Immunsystem von Beginn einer Infektion an. So bildeten die Patienten im Durchschnitt weniger T-Zellen als die Patientinnen. Zudem wiesen die erkrankten Frauen reifere und also effizientere T-Zellen auf.
Keine Unterschiede fanden die Wissenschafter hingegen bei einer anderen Abteilung des Immunsystems: Alle Erkrankten bildeten ähnlich viele Antikörper gegen Sars-CoV-2. Diese werden von anderen Immunzellen, sogenannten B-Zellen, hergestellt.
Die Yale-Forscher fanden in ihren Untersuchungen jedoch nicht nur eine Erklärung, warum Frauen sich besser gegen das Virus zur Wehr setzen können. In weiteren Analysen zeigte sich, dass eine Verschlechterung des Zustands im Verlauf von Covid-19 bei den Geschlechtern aus unterschiedlichen Gründen erfolgte.
So trat bei den Patientinnen eine Verschlechterung ein, wenn gewisse Stimulatoren des unspezifischen Immunsystems vermehrt produziert wurden und dieses dadurch angeheizt wurde. Bei der unspezifischen Abwehr sind nochmals andere Zellen aktiv. Diese bekämpfen Eindringlinge mit anderen Mitteln als die B- oder die T-Zellen.
Bei den Männern wurde es hingegen kritischer, wenn die Zahl der reifen T-Zellen abnahm, also ihre ohnehin schon schwächere spezifische Immunantwort noch mehr nachliess. Erstaunlicherweise war in der Yale-Studiengruppe nur bei den Männern, nicht aber bei den Frauen Übergewicht ein Risikofaktor für eine Verschlechterung des Gesundheitszustands. Zudem nahmen die reifen T-Zellen vor allem bei den Männern, nicht hingegen bei den Frauen mit zunehmendem Alter deutlich ab.
25. August: Erstmals bestätigen Forscher eine Zweitinfektion mit dem Coronavirus
lsl.· Schon zu Beginn der Pandemie gab es immer wieder Meldungen, dass sich Menschen ein zweites Mal mit Sars-CoV-2 infiziert haben. Doch konnte dies nie überzeugend belegt werden. Wahrscheinlicher erschien jeweils, dass die Betroffenen das Virus lange nicht los wurden. Nun haben Wissenschafter erstmals überzeugende Belege dafür gefunden, dass sich ein Covid-19-Patient zum zweiten Mal mit dem Virus infiziert hat. Das geht aus einer noch nicht begutachteten Publikation hervor. Die Forscher konnten nämlich nachweisen, dass es sich bei der zweiten Infektion um einen anderen Stamm von Sars-CoV-2 handelte. Da es sich bis anhin um einen Einzelfall handelt, ist das Ergebnis mit Vorsicht zu behandeln.
Einen ausführlichen Bericht über die Studie finden Sie hier.
24. August: Die Suche nach dem Zwischenwirt – Marderhunde sind für Sars-CoV-2 empfänglich
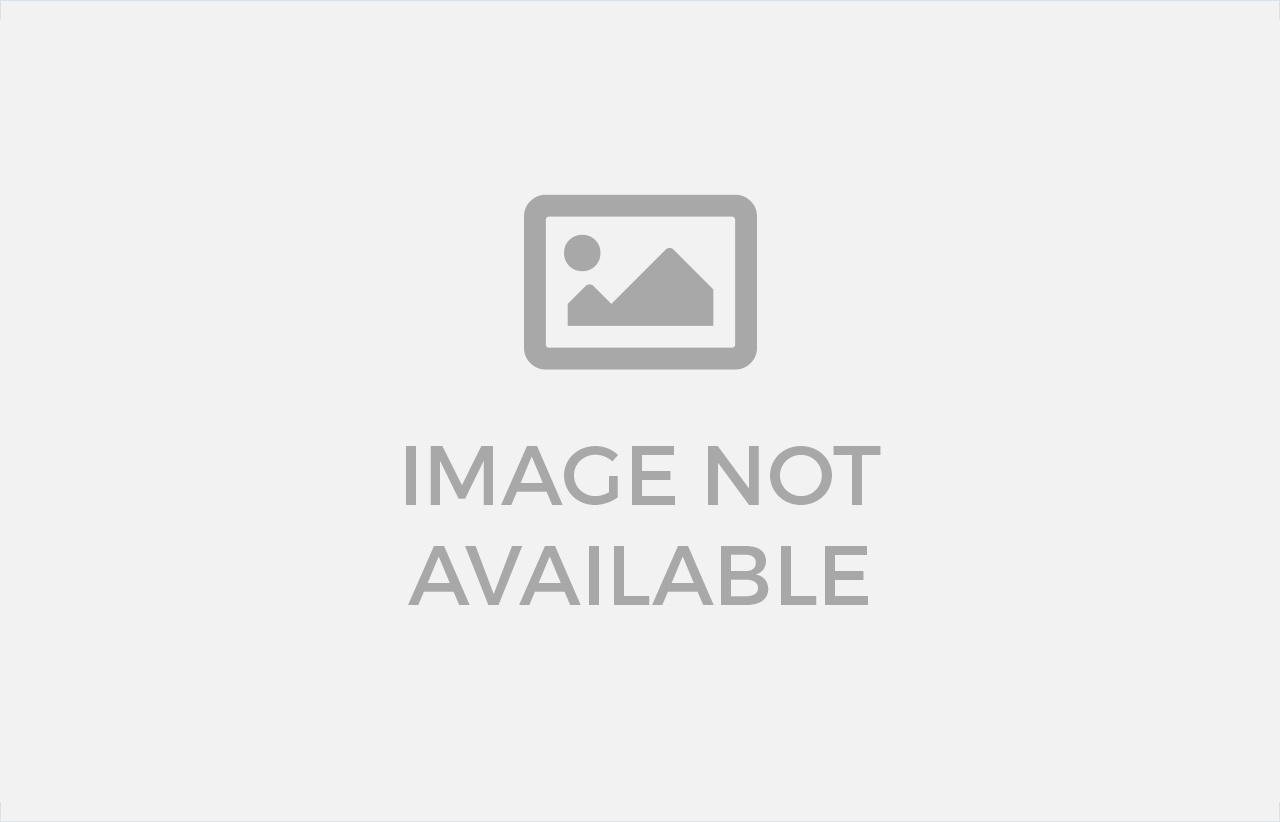
kus. · Noch immer ist der vermutete Zwischenwirt unbekannt, von dem das neue Coronavirus auf den Menschen übergesprungen ist. Bis anhin hat man nur enge Verwandte von Sars-CoV-2 in Wildtieren gefunden. Für einen möglichen Kandidaten konnten Wissenschafter des Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI) in Deutschland nun bestätigen, dass er für das Virus empfänglich ist: den Marderhund, der primär in China zu Millionen als Pelztier gezüchtet wird.
Wie die Forscher in einer Vorabveröffentlichung auf dem Preprint-Server BioRxiv beschreiben, beeinträchtigt die Infektion mit Sars-CoV-2 die Marderhunde in ihrem Experiment praktisch nicht. Sie entwickelten lediglich einen leichten Schnupfen, und einzelne Tiere waren kurz nach der Infektion etwas stiller als sonst. Letzteres habe man aber nur bemerkt, wenn man sie gut kannte und genau beobachtete, sagt Conrad Freuling vom FLI, der Erstautor der Studie. Das Virus schieden sie trotzdem aus und konnten Artgenossen damit anstecken – gute Voraussetzungen für einen Zwischenwirt.
Zudem veränderte sich das Virus in den Marderhunden nicht, es blieb genetisch stabil. In Frettchen-Versuchen des FLI war dies anders. Auch das könnte dafür sprechen, dass das Virus die Umgebung «Marderhund» kennt. Das ist laut Thomas C. Mettenleiter vom FLI aber zurzeit noch Spekulation. Möglicherweise handle es sich auch um einen Zufallsbefund. Trotzdem raten die Forscher mindestens zur Überwachung von Pelzfarmen. Zudem könnte es interessant sein, ältere Proben – falls solche existierten – auf das Vorhandensein des Virus und auf Sars-CoV-2-spezifische Antikörper zu überprüfen, sagt Mettenleiter.
Die zur Familie der Hunde gehörenden Tiere ähneln Waschbären und waren schon beim ersten Sars-Virus als mögliche Zwischenwirte im Gespräch. Sie sind ursprünglich in Ostasien heimisch, von wo aus sie als Pelztiere nach Russland gebracht wurden. Mittlerweile haben sich die unauffällig lebenden Allesfresser nicht nur in Nord- und Osteuropa etabliert, sie bilden stabile Populationen auch in Deutschland oder den Niederlanden und werden auch in der Schweiz immer wieder einmal gesichtet.
Dass sie infizierbar sind, eröffnet auch die Möglichkeit, dass das Virus über eine Infektion von Marderhunden in die Natur gelangt. In den USA fand eine ebenfalls noch nicht von Fachkollegen begutachtete, auch auf BioRxiv veröffentlichte Studie, dass dort die weitverbreitete Hirschmaus empfänglich für Sars-CoV-2 ist. Auch sie wird kaum krank, kann aber Artgenossen anstecken.
Für den Menschen wären solche Infektionen von Wildpopulationen zwar vermutlich kein Risiko. Das Virus kursiert ohnehin in der menschlichen Population, und die Wahrscheinlichkeit, sich an einem Tier anzustecken, ist extrem niedrig. Man kennt laut Mettenleiter lediglich zwei Fälle von Mitarbeitern von Nerzfarmen, in denen man vermutet, dass sich die Personen an Nerzen angesteckt haben – in geschlossenen Räumen und im engem Kontakt mit sehr vielen erkrankten Tieren.
Allerdings besteht beim Übergreifen des Virus auf wilde Populationen die Gefahr, dass das Virus in der Natur weitergetragen wird und dabei möglicherweise in eine Tierart gelangt, die es nicht verträgt und durch die neue, unbekannte Infektion gefährdet werden könnte. Und nicht zuletzt trage das Wissen darum, welche Tiere möglicherweise infiziert werden oder gar sogenannte sekundäre Reservoire für das Virus bilden könnten, dazu bei, dessen Epidemiologie besser zu verstehen, sagt Mettenleiter.
20. August: 3 von 1000 infizierten Personen im mittleren Alter sterben an Covid-19 – Forscher präsentieren altersabhängige Todesfallraten
ni. · Seit Beginn der Corona-Pandemie wird darüber diskutiert, wie gefährlich Sars-CoV-2 tatsächlich sei. Schon relativ früh stellte man fest, dass vor allem ältere und durch Vorerkrankungen geschwächte Personen nach einer Infektion mit dem Erreger sterben. Wie sich diese Beobachtung auf die altersabhängigen Todesfallraten auswirkt, wird von verschiedenen Wissenschaftern untersucht. In einer im Pre-Print-Server Medrxiv erschienenen neuen Meta-Analyse hat eine amerikanische Forschergruppe um den Ökonomen Andrew Levin vom Dartmouth College in New Hampshire die altersabhängigen Daten zur Seroprävalenz (das Vorhandensein von spezifischen Antikörpern, die auf eine Infektion schliessen lassen) und zur Infection Fatality Rate (IFR, d. h. die Zahl der Verstorbenen geteilt durch diejenige der Infizierten) aus zwölf Ländern analysiert.
Die Studie zeigt folgendes Bild: Bei Kindern und jungen Erwachsenen liegt die IFR praktisch bei null, das heisst, Todesfälle in dieser Altersgruppe sind die absolute Ausnahme. Mit zunehmendem Alter der Infizierten steigt die IFR exponentiell an. Bei den 50- bis 59-Jährigen beträgt sie 0,3 Prozent, das heisst 3 von 1000 Infizierten sterben. Bei den 60- bis 69-Jährigen beträgt die Rate 1,3 Prozent, bei den 70- bis 79-Jährigen 4 Prozent, bei den 80- bis 89-Jährigen 10 Prozent und bei den über 90-Jährigen 25 Prozent. Die Zahlen besagen, dass selbst in der Gruppe der Hochbetagten der Grossteil der Personen die Infektion mit Sars-CoV-2 überlebt.
Trotzdem seien die Gefahren insgesamt nicht zu vernachlässigen, schreiben die Forscher. Sie haben berechnet, dass für Personen im mittleren Alter das Risiko, an Covid-19 zu sterben, mehr als 50 Mal höher liegt als dasjenige, in einem Jahr durch einen Autounfall zu Tode zu kommen. Gleichzeitig betonen sie, dass die Ergebnisse der Studie zeigten, dass der Einzelne und die Gesellschaft alles unternehmen sollten, um Ansteckungen in den Risikogruppen zu verhindern – denn damit lasse sich die Zahl der Toten beträchtlich reduzieren.
18. August: Offenbar wenig Einfluss der Schulöffnung in Norwegen auf die Reproduktionszahl
kus. · Wie viele andere Länder schloss auch Norwegen als eine der Massnahmen, um der steigenden Infektionszahlen mit Sars-CoV-2 Herr zu werden, Schulen und Kindergärten. Das geschah am 13. März. Die Kindergärten öffneten bereits am 20. April wieder; die letzten Schüler konnten ab dem 11. Mai wieder in ihre Schulhäuser zurückkehren – jeweils unter Beachtung bestimmter Sicherheitsmassnahmen. Zu dieser Zeit wurde die Reproduktionszahl in Norwegen auf 0,7 geschätzt, mit einem Spielraum von 0,45 bis 1.
Forscher der Arctic University of Norway haben nun modelliert, wie die Öffnung der Schulen in Oslo und Tromsö die Reproduktionszahl des Virus beeinflusst hat. Sie gingen dabei von einer Übertragungsrate von Sars-CoV-2 in Schulen aus, wie man sie für die Grippe annimmt. Ihre Resultate – die noch nicht von Fachkollegen begutachtet worden sind – veröffentlichten sie auf dem Preprint-Server Medrxiv.
Wie sich zeigte, beeinflusste die Öffnung die Reproduktionszahl in der Modellierung nur wenig: In Oslo stieg sie demnach um 0,10 und in Tromsö um 0,14. Diese Ergebnisse passen laut Martin Rypdal, dem Erstautor der Studie, dazu, dass die Schulöffnungen in Norwegen die Reproduktionsrate nicht über 1 trieben. Die Forscher gehen daher davon aus, dass die kontrollierte Öffnung von Schulen dann sicher ist, wenn ein Land den Ausbruch unterdrückt hat und die Reproduktionsrate genügend tief ist.
Die modellierten Werte waren relativ stabil gegenüber Änderungen in der Übertragungsrate in den Schulen: Setzten die Forscher diese 20 Prozent höher an als jene für die Grippe, stieg die Reproduktionszahl um 0,25. Das scheint zwar wenig, kann allerdings sehr viel bewirken, wenn es die Reproduktionszahl über 1 treibt.
Andere Berechnungen hatten ergeben, dass das Schliessen von Schulen einen grossen Effekt auf den Fortgang der Pandemie gehabt haben könnte. Die Forscher sehen darin allerdings keinen Widerspruch. Die Öffnung sei graduell geschehen, bei einer niedrigen Reproduktionszahl und im Kontext weiterer sozialer Distanzierungsmassnahmen in der Gesellschaft, also in einem grundlegend anderen Szenario als Schliessungen inmitten eines «unkontrollierten» Ausbruchs.
Allerdings müsse man sich bewusst sein, sagt Tanja Stadler von der ETH Zürich, dass – wenn die Fallzahlen stiegen – es auch vermehrt zu Ausbrüchen an Schulen kommen könnte, wie man dies auch in anderen Ländern sehe. Falls die Zahlen so stiegen, dass neue Massnahmen erforderlich würden, um eine weitere Welle abzuwenden, sei es essenziell, zu verstehen, wo die Ansteckungen stattfänden. Hierfür brauche es unbedingt ein funktionierendes Contact-Tracing mit zeitnah verfügbaren Daten, fordert die Wissenschafterin. Denn der Einfluss der Schulen auf die Epidemie sei nicht abschliessend geklärt, und unnötige Schulschliessungen müssten verhindert werden.
Die Kantone handhaben die Maskenpflicht an den Schulen unterschiedlich
Maskenpflicht-Regelungen der Kantone an Berufs- und Mittelschulen
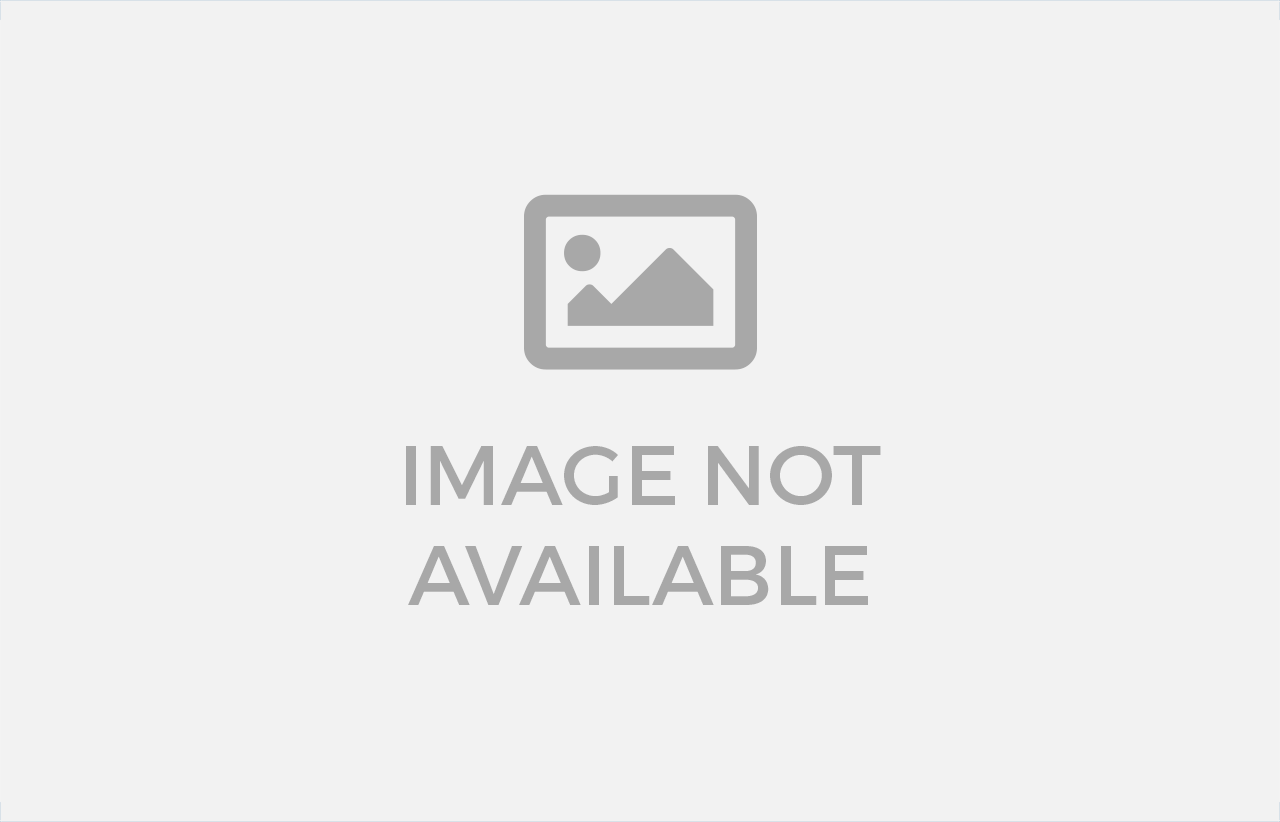
14. August: Ein mathematisches Modell erklärt die unterschiedlichen Ausbreitungsmuster von Grippeviren und Sars-CoV-2
Spe. · Zwischen dem Grippe-Erreger und Sars-CoV-2 gibt es einige Gemeinsamkeiten. Es gibt aber auch erhebliche Unterschiede. Ein ganz wesentlicher ist, dass sogenannte Superspreader massgeblich zur Ausbreitung von Sars-CoV-2 beitragen. Man schätzt, dass 80 Prozent aller Ansteckungen auf das Konto von 10 bis 20 Prozent der Infizierten gehen. Im Umkehrschluss bedeutet das: Die grosse Mehrheit der Infizierten steckt nie eine andere Person an. Das ist bei der Grippe anders. Hier fallen individuelle Unterschiede viel weniger ins Gewicht.
Warum das so ist, haben Forscher des Fred Hutchinson Cancer Research Center mit einem mathematischen Modell zu beantworten versucht. In das Modell fliessen diverse epidemiologische Parameter ein. Diese werden so lange variiert, bis das Resultat der Simulation möglichst gut mit den beobachteten Ausbreitungsmustern des Grippe- oder des Coronavirus übereinstimmt. Die Forscher haben ihre Ergebnisse auf dem Medrxiv-Server publiziert. Sie sind bisher aber noch nicht von unabhängiger Seite begutachtet worden.
Ein Resultat der Simulation ist, dass das Zeitfenster für eine Infektion sowohl bei der Grippe als auch bei Sars-CoV-2 kleiner als zwei Tage ist. Nur in dieser Zeit überschreitet die Virenlast in der Lunge oder im Nasen- und Rachenraum der Infizierten eine Schwelle, die eine Ansteckung anderer Personen wahrscheinlich macht. Zu einem Superspreading-Ereignis kommt es demnach, wenn sich ein Infizierter zur falschen Zeit am falschen Ort befindet und Kontakt zu vielen Menschen hat.
Eine Besonderheit von Sars-CoV-2 ist, dass die höchste Virenlast in der Regel erreicht wird, bevor der Infizierte erste Symptome verspürt. Er verbreitet das Virus also unwissentlich. Das erklärt allerdings noch nicht, warum Superspreading-Ereignisse bei der Grippe weitaus seltener sind. Das Modell der Forscher liefert eine mögliche Antwort. Es zeigt, dass bei gleichen Kontaktverhältnissen weniger Menschen mit den Viren eines hochinfektiösen Grippepatienten in Berührung kommen. Die Forscher führen das darauf zurück, dass Grippeviren vornehmlich durch Tröpfchen übertragen werden, während Sars-CoV-2 auch durch Aerosole verbreitet wird und deshalb grössere Entfernungen überbrücken kann.
Aus den Ergebnissen ihrer Simulation leiten die Forscher eine Reihe von Handlungsempfehlungen ab. Da Personen mit Sars-CoV-2 vermutlich nur wenige Tage ansteckend seien, stelle sich die Frage, ob eine lange Quarantäne gerechtfertigt sei. Auch das wiederholte Testen von Personen mit einem positiven Testresultat sei möglicherweise überflüssig. Zudem raten die Forscher, die Zahl der täglichen Kontakte zu begrenzen. Sei das nicht möglich, empfehle sich das Tragen von Masken, da dadurch die Menge der ausgestossenen Viren reduziert werde.
13. August: Forscher weisen lebensfähige Viruspartikel in winzigen Schwebeteilchen nach
(sda/dpa) Amerikanische Forscher haben in Versuchen bestätigt, dass von Corona-Infizierten ausgestossene Aerosole intakte Viruspartikel enthalten können. Das sei eine Bestätigung dafür, dass Sars-CoV-2 wahrscheinlich auch über die winzigen, lange in der Luft verbleibenden Schwebeteilchen übertragen werden könne. In Räumen eineinhalb oder auch zwei Meter Sicherheitsabstand zu wahren, könne mithin ein falsches Gefühl von Sicherheit vermitteln, heisst es in der Studie. Diese ist allerdings noch nicht in einem Fachjournal veröffentlicht und damit noch nicht von unabhängigen Gutachtern geprüft.
Dass Sars-CoV-2 nicht nur über grössere Tröpfchen, sondern auch über winzige Schwebeteilchen übertragen werden kann, gilt schon länger als gesichert. Unklar ist allerdings, wie gross der Anteil der Aerosole bei den Ansteckungen ist. Generell gilt das Risiko in Innenräumen als wesentlich höher als draussen, wo sich Partikel rascher verflüchtigen.
Die Forscher um John Lednicky von der University of Florida in Gainesville untersuchten nun Proben der Raumluft aus der Umgebung zweier Covid-19-Patienten in einem Klinikzimmer. Selbst aus Proben, die in fast fünf Metern Abstand zu den Patienten genommen worden seien, seien noch aktive Sars-CoV-2-Partikel isoliert worden, berichten die Forscher. Über genetische Analysen sei bestätigt worden, dass diese von dem Patienten mit Covid-19-Atemwegssymptomen im Raum stammten – und nicht etwa aus einem anderen Bereich der Klinik eingetragen worden seien.
Die Analyse sagt nichts darüber aus, ob die Virenlast in der Luft ausreicht, um weitere Menschen anzustecken. Superspreader-Ereignisse etwa bei Chorproben weisen allerdings schon seit längerem darauf hin, dass Viruspartikel in Aerosolen die Infektion vieler Menschen im Umkreis zur Folge haben können.
10. August: Ein einfacher Test von Schutzmasken mit Smartphone und Laserlicht
Spe. · Schutzmasken gegen Covid-19 gehören inzwischen in vielen Ländern zum Strassenbild. Dem Einfallsreichtum sind dabei kaum Grenzen gesetzt. Während die einen auf chirurgische Masken schwören, nähen sich die anderen ihre Masken selbst oder wickeln sich einfach ein Halstuch um Mund und Nase. In der Fachzeitschrift «Science Advances» haben Wissenschafter der Duke University in Durham nun eine einfache Methode vorgestellt, um die Wirksamkeit verschiedener Maskentypen zu vergleichen. Das Prüfsystem koste weniger als 200 Dollar und lasse sich auch von Nichtexperten bedienen, schreiben die Forscher in ihrer Publikation.
Das Tragen einer Maske dient primär dem Schutz von anderen. Die Maske soll verhindern, dass ein Infizierter beim Sprechen, Niesen oder Husten virenbelastete Tröpfchen in die Umwelt ausstösst. Das Problem ist, dass diese Tröpfchen sehr klein sein können und mit blossem Auge kaum wahrzunehmen sind. In der Regel ist deshalb aufwendiges Equipment nötig, um die Dichtigkeit einer Maske beurteilen zu können.
Zwingend ist das allerdings nicht. Den Forschern aus Durham genügte zum Nachweis der Tröpfchen ein handelsüblicher Laser und ein Smartphone. Das aufgefächerte Laserlicht kreuzt in einer dunklen Box die ausgeatmete Luft und wird an den winzigen Tröpfchen gestreut. Die Kamera des Smartphones zeichnet das Streulicht auf. Anschliessend zählt ein einfacher Computer-Algorithmus die ausgestossenen Tröpfchen.
Die Forscher machten die Probe aufs Exempel und liessen eine Versuchsperson fünfmal hintereinander den Satz «Stay healthy, people» sagen. Dieser Versuch wurde mit 14 verschiedenen Masken wiederholt. Zum Vergleich wurde die Zahl der Tröpfchen herangezogen, die der gleiche Sprecher ohne Maske ausstösst.
Die Unterschiede waren frappant. Am besten schnitten Masken vom Typ N95 ab (vergleichbar mit FFP2-Atemschutzmasken in Europa). Mit dieser Maske wurde die Zahl der ausgestossenen Tröpfchen auf ein Tausendstel der Menge ohne Maske reduziert. Eine fast ebenso gute Filterwirkung zeigten die weitverbreiteten chirurgischen Masken. Und auch selbstgenähte Masken aus Baumwolle zeigten ein gutes Resultat.
Von Halstüchern raten die Autoren hingegen ab. Sie halbierten die Zahl der Tröpfchen lediglich. Noch schlechter waren Halstücher aus Fleece1. Hier zählten die Forscher in der ausgestossenen Luft sogar mehr Tröpfchen als ohne Maske. Sie führen das darauf zurück, dass grössere Tröpfchen im Gewebe in kleinere Tröpfchen zerlegt werden. Solche Tücher seien sogar kontraproduktiv, weil kleinere Tröpfchen länger in der Luft verweilten als grosse.
1 In einer früheren Version dieses Artikels war fälschlicherweise von Masken aus Vlies die Rede. Gemeint sind Halstücher aus Fleece. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.
Die verschiedenen Gesichtsmasken
Schützt in erster Linie das Umfeld des Trägers. Grössere Tröpfchen werden zuverlässig zurückgehalten. Die Maske empfiehlt sich für all jene, die Kontakt zu besonders gefährdeten Personen haben und diese vor einer Infektion schützen wollen. Dies auch vor dem Hintergrund, dass etwa die Hälfte der Ansteckungen durch Personen erfolgt, die selbst noch keine Symptome entwickelt haben.
3. August: Hunde und Katzen können mit Sars-CoV-2 angesteckt werden – bei Schweinen, Hühnern und anderen Nutztieren gibt es keine Hinweise darauf.
(dpa/mv) Haustiere wie Hunde und Katzen können von Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert werden. Diese Annahme von Wissenschaftern hat jetzt eine Studie italienischer Forscher mit einer grossen Zahl von Tieren bestätigt. Die Forscher untersuchten zwischen März und Mai 2020 insgesamt 540 Hunde und 277 Katzen in Norditalien, vor allem in der Lombardei. Die Tiere lebten in Haushalten mit Corona-Patienten oder in besonders stark von Corona betroffenen Gebieten.
Bei 3,4 Prozent der Hunde und 3,9 Prozent der Katzen konnten die Forscher Antikörper gegen das Virus nachweisen. Das deutet auf eine zurückliegende Infektion hin. Die Tests auf das Virus selbst (in Abstrichen aus dem Mund-, Nasen- und Rachenraum) waren dagegen bei allen Tieren negativ. Das hat damit zu tun, dass die Virenausscheidung nach zwei Wochen endet. Die Ergebnisse der Studie wurden vorab veröffentlicht und noch nicht von wissenschaftlichen Fachkollegen begutachtet.
Laut dem Präsidenten des deutschen Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI) in Greifswald, Thomas Mettenleiter, bestätigt die Studie, was man schon weiss. Es sei jedoch gut, eine Studie mit einer solchen Anzahl an Haustieren zu haben. «Wir gehen davon aus, dass im Regelfall die Übertragung des Virus vom Menschen auf das Tier erfolgt», sagte Mettenleiter. Lediglich in einer Nerzfarm in den Niederlanden sei es möglicherweise umgekehrt gewesen. Aber auch dort sei der erste Eintrag in die Farm durch Menschen geschehen.
Die Studie bestätige die bisherige Einschätzung des FLI, dass Hunde oder Katzen bis jetzt keine Rolle bei der Verbreitung von Sars-CoV-2 spielten. Ausschlaggebend sei die Übertragung von Mensch zu Mensch. Der Kontakt gesunder Menschen zu Haustieren muss aus derzeitiger Sicht des FLI nicht eingeschränkt werden. Infizierte Personen sollten den Kontakt zu Haustieren meiden. Auch wenn sich Haustiere infizieren, bedeutet das laut dem FLI nicht automatisch, dass sich das Virus in den Tieren vermehren kann und von ihnen auch wieder ausgeschieden wird.
Laut Mettenleiter gibt es bis jetzt keinen Nachweis, dass Tiere nach einer Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind. Auch in der italienischen Studie waren nur lebendige Tiere untersucht worden. In den USA sei ein vor kurzem positiv getesteter Hund gestorben, der aber auch noch an Krebs erkrankt gewesen sei.
Laut dem FLI gibt es bis anhin auch keine Hinweise darauf, dass sich Schweine, Hühner und andere landwirtschaftliche Nutztiere mit Sars-CoV-2 infizieren können. Am Institut erfolgen derzeit Versuche mit mehreren Tierarten. Nach ersten Ergebnissen sind Frettchen und Flughunde für das Virus empfänglich, Hühner und Schweine jedoch nicht. Studien mit Rindern wurden erst begonnen.
29. Juli: Herdenimmunität in Mumbai? In drei Slums haben fast 60 Prozent der Bewohner Antikörper gegen Sars-CoV-2
lsl. · Forscher vom indischen Tata Institute of Fundamental Research haben im Juli bei 7000 Menschen in Mumbai Blutproben genommen und diese auf Antikörper gegen Sars-CoV-2 getestet. Laut der BBC fanden sie bei 57 Prozent der Bewohner von drei Slums Antikörper, ausserhalb der Slums war dies nur bei 16 Prozent der Einwohner der Fall. In den untersuchten Slumgebieten leben 1,5 Millionen Menschen.
Falls eine einmalige Erkrankung zur Immunität führen würde, wäre in diesen Gebieten die ersehnte Herdenimmunität knapp erreicht. Man geht davon aus, dass dafür 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung immun sein müssen. Allerdings haben Studien gezeigt, dass die Antikörper im Blut von Covid-19-Patienten bereits 90 Tage nach der Infektion stark zurückgehen; ob damit auch die Immunität abnimmt, ist derzeit noch unklar.
Laut der Untersuchung hatten die meisten Menschen in den untersuchten Gebieten in Mumbai nur leichte Symptome, und nur einer von 1000 bis 2000 Menschen starb an einer nachgewiesenen Covid-19-Erkrankung, wie die BBC schreibt.
Mit mehr als 1,5 Millionen positiv getesteten Covid-19-Patienten zählt Indien nach den USA und Brasilien zu den am meisten betroffenen Ländern. Aber womöglich ist die Dunkelziffer in Indien grösser als in den USA. Eine Untersuchung der indischen Regierung hatte kürzlich auch gezeigt, dass in der Hauptstadt Delhi einer von vier Einwohnern Antikörper gegen Sars-CoV-2 trug. In New York war dies bei einem von fünf Bewohnern der Fall.
29. Juli: Beatmete Covid-19-Patienten haben ein besonders hohes Risiko zu sterben
slz. · Gut ein Fünftel der Covid-19-Patienten, die zwischen Ende Februar und Mitte April in Deutschland in Spitäler eingeliefert wurden, verstarben an der Viruserkrankung. Damit liegt Deutschland im internationalen Vergleich im unteren Bereich. Dies zeigt eine neue Studie mit über 10 000 Covid-19-Patienten, die in der Fachzeitschrift «The Lancet Respiratory Medicine» publiziert wurde. Allerdings starben in den Spitälern 53 Prozent aller Covid-19-Patienten, die beatmet werden mussten und also einen schweren Verlauf gezeigt hatten.
Eine ausführliche Darstellung, wie es Covid-19-Patienten in deutschen Spitälern während der Hochphase der Corona-Pandemie ergangen ist, finden Sie hier.
27. Juli: Die einschränkenden Massnahmen haben viele Menschenleben gerettet, wie eine Modellrechnung zeigt
lsl. · Bis am 10. Mai sind in der Schweiz mehr als 30 000 Menschen positiv auf Covid-19 getestet worden, 1860 von ihnen sind gestorben. Der Epidemiologe Christian Althaus und seine Kollegen von der Universität Bern haben mit einer Modellrechnung untersucht, wie viele Opfer es gegeben hätte, wenn der Lockdown eine Woche früher oder eine Woche später erfolgt wäre. Die Massnahmen wie das Versammlungsverbot, Schul-, Restaurant- und Ladenschliessungen wurden um den 17. März herum gestaffelt umgesetzt.

Laut den Forschern hätte es bei einer späteren Schliessung insgesamt knapp 8700 Todesfälle gegeben, was mehr als viermal so viel ist wie die Anzahl derer, die tatsächlich gestorben sind. Bei einer früheren Schliessung wären es nur 400 Todesfälle gewesen, wie sie in einer noch vorläufigen Publikation auf MedRxiv schreiben. Die Forscher gaben für die spätere Schliessung ein Prognoseintervall zwischen 8038 und 9453 an, was bedeutet, dass der angegebene Wert mit einer 95-prozentigen Wahrscheinlichkeit in diesen Bereich fällt.
Eine Stärke des Modells sei, dass sie die Menge der Infizierten anhand der Zahlen der hospitalisierten und der verstorbenen Patienten geschätzt hätten, schreiben die Forscher. So mussten sie sich nicht auf die Zahl der Getesteten verlassen, die von der jeweiligen Testhäufigkeit abhängt.
Allerdings beruht die Rechnung wie jede Modellrechnung auch auf einigen Annahmen, die das Ergebnis beeinflussen. Beispielsweise rechneten die Forscher mit einer geschätzten Reproduktionszahl von 2,6 von vor dem Lockdown und übernahmen bestimmte Zahlen wie etwa die durchschnittliche Dauer der Hospitalisation aus der Literatur. Zudem war das Modell nicht dafür ausgelegt, den Effekt einzelner Massnahmen zu berechnen. Stattdessen nahmen die Forscher an, dass die Massnahmen die Infektionsrate in einem Zeitraum von zwei Wochen um den 17. März herum reduzierten.
Deshalb kann man die genannten Zahlen nicht als gesetzt betrachten. Klar ist aber, dass ein späterer Lockdown zu sehr viel mehr Toten geführt hätte und frühere einschränkende Massnahmen viele Leben gerettet hätten. Das könne laut den Forschern auch teilweise erklären, warum in Österreich viel weniger Menschen gestorben seien als in der Schweiz. Das Nachbarland sei wegen seiner Nähe zu Italien ebenfalls früh betroffen gewesen, da es aber schneller strikte Massnahmen umgesetzt habe, sei es glimpflicher davongekommen.
24. Juli: Der Superspreader des Corona-Ausbruchs in der Schlachterei Tönnies ist identifiziert
Spe. · Der Corona-Ausbruch in der Schlachterei Tönnies im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen ist vermutlich nicht auf die prekären Wohnverhältnisse der Wanderarbeiter zurückzuführen. In einer noch nicht begutachteten Studie kommen Forscher aus Deutschland zum Schluss, dass die Übertragung des Sars-CoV-2-Erregers wahrscheinlich durch Aerosole erfolgte und durch die speziellen Bedingungen am Arbeitsplatz begünstigt wurde. Laut offiziellen Angaben wurden damals mehr als 1400 der über 6000 Angestellten von Tönnies positiv auf das Virus getestet.
Das Team um Melanie Brinkmann vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig hat die Ausbreitung des Virus nun anhand einer Genomanalyse rekonstruiert. Als Superspreader wurde ein Angestellter identifiziert, der sich zuvor bei Mitarbeitern eines Fleisch verarbeitenden Unternehmens in Niedersachsen angesteckt hatte. Das bei ihm nachgewiesene Virus zeigte eine charakteristische Kombination von acht Mutationen. Die gleichen Mutationen wurden dann auch bei anderen positiv getesteten Tönnies-Mitarbeitern isoliert, die mit dem Superspreader in der gleichen Schicht zusammengearbeitet hatten.
Die ersten Ansteckungen erfolgten demnach in einer Halle, in der Rinder zerlegt wurden. Wie die Forscher herausfanden, wurden dort innerhalb von drei Tagen 60 Prozent derjenigen Mitarbeiter infiziert, die in einem Abstand von mehr als acht Metern vom Superspreader gearbeitet hatten. Hingegen fanden die Forscher keine Hinweise darauf, dass die Wohnverhältnisse der Arbeiter massgeblich zum ersten Ausbruch beigetragen hätten. In den Unterkünften habe es höchstens sekundäre Ansteckungen gegeben. Nicht ausschliessen wollen die Forscher, dass die beengenden Verhältnisse in den Gemeinschaftsunterkünften zu einem zweiten Ausbruch beigetragen haben, der einen Monat später erfolgte.
Die Untersuchung weist darauf hin, dass das Einhalten eines Mindestabstands von zwei Metern unter bestimmten Bedingungen nicht genügt, um sich vor einer Corona-Ansteckung zu schützen. In der Halle wurde die Luft auf zehn Grad gekühlt, und es gab kaum Frischluftzufuhr. Vielmehr wälzte die Klimaanlage die virushaltige Luft immer wieder um, ohne sie zu filtern. Zudem liess die schwere körperliche Arbeit die Angestellten tiefer atmen. Dieser Mix von ungünstigen Faktoren habe die Ausbreitung des Virus durch Schwebeteilchen in der Luft (Aerosole) begünstigt, schreiben die Autoren in ihrer Publikation. Es sei sehr wahrscheinlich, dass diese oder ähnliche Faktoren auch für die Ausbrüche in anderen Fleisch oder Fisch verarbeitenden Betrieben verantwortlich seien.
22. Juli: Welche Covid-19-Patienten von Cortisonpräparaten profitieren – und wem die Mittel schaden
slz. · Dexamethason, ein altbekanntes Cortisonpräparat, ist derzeit das einzig bekannte Medikament, dass bei Covid-19-Patienten nachweislich das Risiko, dass eine Beatmung nötig wird, sowie die Todesrate senken kann. Das ergab kürzlich der britische «Recovery»-Trial. Nun zeigen Forscher des New Yorker Montefiore Medical Center in einer Publikation im «Journal of Hospital Medicine», welche Betroffenen wirklich von einer Cortisonbehandlung profitieren – und welchen Personen die Mittel schaden können.
Das hängt laut den New Yorker Ärzten vom Entzündungszustand des Körpers ab. Dieser lässt sich mit dem CRP-Wert ermitteln. Je mehr von diesem Protein im Blut zu finden ist, desto «aufgeputschter» ist das Immunsystem. Als normal gilt ein CRP-Wert von 0,5 bis 0,8 Milligramm pro Deziliter. Betrug der CRP-Wert der im Montefiore-Spital behandelten Covid-19-Patienten bei der Einlieferung mehr als 20 Milligramm pro Deziliter, so senkten Cortisonpräparate das Risiko, beatmet werden zu müssen oder gar zu sterben, um 75 Prozent. Gab man die Mittel hingegen Patienten mit einem CRP-Wert unter 10, so stieg deren Risiko für eine Verschlimmerung des Zustandes um 200 Prozent an.
Diese Ergebnisse sollten schnellstmöglich in weiteren Studien überprüft und, sollten sich die Befunde bestätigen, weltweit bei der Behandlung von Covid-19-Patienten beachtet werden, fordern die Autoren. Denn die Messung des CRP-Wertes ist einfach; er wird routinemässig bei Blutuntersuchungen erfasst. Ausserdem wird der Gebrauch von Dexamethason bei Covid-19-Patienten absehbar zunehmen: Das Mittel ist billig, man weiss, wie es einzusetzen ist, und nach der Präsentation der Recovery-Trial-Daten wurde es in einigen Ländern bereits in die offizielle Empfehlungsliste für eine Covid-19-Therapie aufgenommen.
Die Erkenntnisse aus New York bestätigen, was Experten schon länger vermuten: Wenn das Immunsystem im Laufe einer Sars-CoV-2-Infektion zu stark aktiviert worden ist und deshalb gesunde Organe in Mitleidenschaft gezogen werden, kann Cortison helfen. Es mindert die Attacken auf intakte Körperzellen. Doch solange das Immunsystem seinen Job bei der Virenvernichtung erledigt, sollte man es durch Medikamente nicht bremsen.
21. Juli: Mehrere Impfstoffe nehmen eine weitere Hürde

slz. · Aus Grossbritannien, China, Deutschland und den USA wurden Fortschritte bei der Entwicklung eines Impfstoffs gegen Covid-19 vermeldet: Vier Impfstoffkandidaten lösen eine Antwort des Immunsystems aus. Die Probanden klinischer Studien bildeten nach der Impfung Antikörper, die Sars-CoV-2 in Zellkulturversuchen neutralisiert haben. Zudem entstanden spezifische T-Zellen, die von dem Erreger befallene Körperzellen erkennen und diese dann vernichten.
Ein Beweis für einen wirksamen Schutz in der realen Welt ist das jedoch noch nicht. Warum, erläutert Wissenschaftskorrespondentin Stephanie Lahrtz in diesem ausführlichen Artikel.
20. Juli: Gurgeln statt Rachenabstrich und ein umfunktionierter Blutgruppentest – Alternativen zu gängigen Corona-Tests
slz. · Der Rachenabstrich beim Test für Sars-CoV-2 kann lästig sein und bei Massentests in Kindergärten oder Schulen sogar unter Umständen auch richtig schwierig. Forscher der Universität Halle stellen nun eine Alternative vor: Sie spürten das Virus auch in Gurgellösungen von Covid-19-Patienten auf. Bereits wenige Milliliter reichten in ersten Versuchen aus, um das Virus mittels einer Massenspektrometrie zu detektieren.
Im gängigen PCR-Test wird genetisches Material der Coronaviren im Rachenabstrich bestimmt. Bei der Massenspektrometrie hingegen werden Proteinstückchen des Virus entdeckt. Man könne daher mit diesem Verfahren das Virus auch dann finden, wenn es sich unbemerkt genetisch verändert habe, erläutert die Studienleiterin Andrea Sinz. Das könne im weiteren Verlauf der Pandemie wichtig werden.
Zudem könnte die Gurgelmethode auch einen bekannten Nachteil des Rachenabstrichs ausmerzen: Man findet dabei nur dann Viren, wenn man an der richtigen Stelle kratzt, also dort, wo die Viren sitzen. Doch gerade bei Personen in der Anfangs- und Endphase der Infektion oder auch bei denjenigen, die nur wenige Viruspartikel abbekommen haben, sind die Erreger oft nicht gleichmässig im Hals verteilt. Beim Gurgeln hingegen erwischt man auch Material aus vereinzelten «Vireninseln». Noch muss die Gurgeltestmethode aber erst validiert werden. Derzeit ist weder die Spezifität noch die Sensitivität bestimmt.
Neben der Detektion einer akuten Infektion durch PCR werden zurzeit weltweit auch Antikörpertests durchgeführt, um Personen mit einer bereits durchgemachten Infektion und so zum Beispiel die Durchseuchung der Bevölkerung zu erfassen. Auch hier wurde nun eine Alternative präsentiert. Eine Arbeitsgruppe der australischen Monash University hat dazu den gängigen Test zur Bestimmung der Blutgruppe umgestaltet. Zeigt bei dem herkömmlichen Test eine Verklumpung einer Blutprobe eine bestimmte Blutgruppe an, so bilden sich die Blutklümpchen im neuen Test nur in Anwesenheit von Sars-CoV-2-Antikörpern im Blut.
Der Vorteil des neuartigen Tests ist die im Vergleich zum derzeitigen Antikörpertest einfachere Handhabung: Er geht schnell, nahezu jedes Labor kann ihn durchführen, und es sind weder neue Geräte noch andere Testabläufe nötig. Allerdings muss auch dieses Verfahren erst noch validiert werden.
17. Juli: In Wuhan haben unentdeckte Infizierte vermutlich massgeblich zur Ausbreitung von Covid-19 beigetragen

Spe. · Ein Charakteristikum von Covid-19 ist, dass die Krankheit auch durch Personen übertragen wird, die selbst keine oder nur schwache Symptome entwickeln. Da sich diese Personen in der Regel nicht testen lassen, gibt es neben der offiziellen Statistik viele Fälle, die nie bestätigt werden. Wie hoch diese Dunkelziffer ist, haben chinesische Wissenschafter jetzt anhand des Covid-19-Ausbruchs in Wuhan modelliert. Sie kommen zum Schluss, dass bis zu 87 Prozent der Infektionen unbemerkt blieben.
Die Untersuchung erstreckte sich über den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 8. März. In diesem Zeitraum wurden in Wuhan nach und nach immer schärfere Massnahmen zur Eindämmung der Epidemie verordnet – von der Abriegelung der Stadt über Massentests bis hin zur Ausgangssperre. Die Modellierung zeigt, dass der Covid-19-Ausbruch von zwei Merkmalen geprägt wurde: der hohen Übertragbarkeit des Virus und der grossen Zahl unentdeckter Fälle. Die Kombination dieser beiden Eigenschaften habe die Eindämmung der Epidemie erschwert, schreiben die Forscher. Dennoch sei es durch das Tragen von Masken, durch Abstandhalten und durch die Quarantäne gelungen, die Übertragung trotz den vielen unbestätigten Fällen zu unterbinden.
Laut den Berechnungen der Forscher steckte ein Infizierter zu Beginn der Epidemie im Schnitt 3,5 andere Personen an. Anfang März lag die Reproduktionszahl dann nur noch bei 0,3. Ohne die eingeleiteten Massnahmen hätte es statt der geschätzten 250 000 Infektionen bis zu 6,3 Millionen geben können. Das bedeutet, dass die Zahl der kumulierten Ansteckungen in Wuhan bis zum 8. März um bis zu 96 Prozent reduziert werden konnte.
Die Untersuchung der chinesischen Forscher enthält zudem eine implizite Warnung davor, zu schnell zum Courant normal zurückzukehren. Hebt man die Massnahmen auf, nachdem es zwei Wochen lang keine bestätigte Infektion mehr gegeben hat, so besteht dennoch eine Wahrscheinlichkeit von 32 Prozent, dass die Epidemie wieder aufflammt. Denn bei einer Dunkelziffer von 87 Prozent gibt es vermutlich immer noch Personen, die das Virus unbemerkt in sich tragen und es an andere weitergeben. Im Modell der Forscher dauerte es nach Aufheben der Restriktionen knapp 40 Tage, bis die Zahl der Fälle wieder über 100 gestiegen war und die zweite Welle ihren Anfang nahm.
16. Juli: Sars-CoV-2 kann das Gehirn direkt und indirekt schädigen

slz. · Die Liste der neuronalen Störungen, die bei Covid-19 schon beobachtet wurden, ist lang. Betroffen sind auch jüngere Patienten oder solche mit einem leichten Verlauf. Unklar ist, ob alle Schäden reparabel sind.
Mehr zu diesem Thema finden Sie in diesem ausführlichen Artikel.
15. Juli: Geschmuggelte Schuppentiere tragen ein Sars-CoV-2-ähnliches Virus – und entwickeln eine Atemwegserkrankung

kus. · Noch immer ist nicht geklärt, von welchem Tier Sars-CoV-2 auf den Menschen übergesprungen ist. Das über das komplette Genom am engsten mit ihm verwandte Virus stammt aus Fledermäusen. Aus Schuppentieren hatten Forscher früh im Verlauf der Pandemie ein Virus isoliert, dessen Rezeptor-Bindungsstelle jener von Sars-CoV-2 extrem ähnlich ist. Mit dieser Stelle dockt das Virus bei der Infektion an Zellen an; die entsprechenden Rezeptoren von Mensch und Schuppentier sind einander sehr ähnlich. Doch nicht nur dies: Auch die von den jeweiligen Erregern verursachten Krankheitsbilder gleichen sich, wie chinesische Forscher in einer noch nicht von Fachkollegen begutachteten Vorabpublikation berichten.
Die Wissenschafter untersuchten geschmuggelte Malaiische Schuppentiere, die im vergangenen Jahr von den Behörden aufgegriffen worden waren, insgesamt waren es 28 Tiere. 15 von ihnen, darunter 6 trächtige Weibchen, hatten eine Atemwegserkrankung entwickelt; Computertomografien zeigten Anzeichen von Lungenentzündungen. Alle infizierten Tiere starben, und Proben verschiedener Gewebe wurden tiefgefroren.
Diese Proben analysierten die Forscher. Das Erbgut von aus ihnen isolierten Coronaviren stimme mit dem jener Proben, die man zuvor aus anderen Schuppentieren isoliert habe, fast vollständig überein, schreiben die Forscher. Das deute darauf hin, dass es sich um einen lokalen Ausbruch mit einer einzigen ursprünglichen Infektionsquelle gehandelt habe.
Die in den Computertomografien gefundenen Lungenentzündungs-Zeichen entsprachen laut den Forschern denjenigen, die Sars-CoV-2 im Menschen verursacht. Auch bei den Schuppentieren war demnach primär die Lunge betroffen, und die Forscher fanden in den Proben Hinweise darauf, dass die Tiere unter Atemnot gelitten haben dürften. Das Virus war neben der Lunge unter anderem auch in der Leber, dem Darm, der Milz und dem Herzen nachweisbar. Auch in drei der Föten infizierter Weibchen konnten die Forscher das Virus nachweisen. Das deutet darauf hin, dass die Föten in der Gebärmutter angesteckt worden waren.
In einem weiteren Schritt untersuchten die Wissenschafter auch noch die Immunreaktion der verschiedenen Tiere. Dabei stellten sie fest, dass erwachsene Schuppentiere, trächtige Weibchen und die ungeborenen Jungtiere jeweils unterschiedlich auf das Virus reagierten.
14. Juli: Übertragung von Sars-CoV-2 in der Gebärmutter

rtz. · Französische Wissenschafter haben zum ersten Mal eine Übertragung von Sars-CoV-2 über die Plazenta von der Mutter auf ihr ungeborenes Kind nachgewiesen. Die Mutter des Kindes war in der 35. Schwangerschaftswoche mit Covid-19-Symptomen hospitalisiert worden; das Baby war drei Tage später per Kaiserschnitt zur Welt gekommen. Die Ergebnisse wurden in «Nature Communications» veröffentlicht.
Über diesen Fall berichtet die Wissenschaftsredaktorin Stephanie Kusma ausführlich in einem separaten Artikel.
Man kannte zwar bereits einige Fälle infizierter Neugeborener, aber in keinem von ihnen konnte der Infektionszeitpunkt – vor der Geburt, während der Geburt oder direkt danach – klar belegt werden. Schon aufgrund dieser Beobachtungen waren in den letzten Wochen einige Mediziner mit der Forderung an die Öffentlichkeit gegangen, Schwangere als Risikogruppe einzustufen.
13. Juli: Die Medikamente Hydroxychloroquin und Lopinavir gelangen nicht in ausreichender Konzentration in die Lunge

Spe. · Das Malariamedikament Hydroxychloroquin und das HIV-Medikament Lopinavir galten einst als Hoffnungsträger im Kampf gegen das Coronavirus. Doch inzwischen stehen die beiden Mittel auf dem Index. Nach Zweifeln an ihrer Wirksamkeit hat die WHO Anfang Juli alle laufenden Studien gestoppt.
Forscher der Universität und des Universitätsspitals Basel haben jetzt eine mögliche Erklärung dafür präsentiert, warum die beiden Medikamente den Erwartungen nicht gerecht werden. Das Team um die Erstautorin Catia Marzolini fand heraus, dass die Konzentration von Hydroxychloroquin und Lopinavir in der Lunge von Covid-19-Patienten nicht ausreicht, um das Virus wirksam zu bekämpfen. Die Forscher haben ihre Resultate in der Fachzeitschrift «Antimicrobial Agents and Chemotherapy» veröffentlicht.
Bei einer Infektion mit dem Sars-CoV-2-Erreger reagiert unser Körper mit einer Entzündungsreaktion. Die Forscher aus Basel stellten fest, dass die dabei ausgeschütteten Zytokine den Abbau von Lopinavir im Körper hemmen. Im Blut von Covid-19-Patienten fanden sie eine dreimal so hohe Konzentration dieses Medikaments wie im Blut von HIV-Patienten. Doch die Covid-19-Patienten profitieren davon nicht. Eine Extrapolation zeigt, dass zu wenig Lopinavir aus dem Blut in die Lunge gelangt. Um das Virus wirksam zu bekämpfen, wäre dort eine etwa hundert Mal so hohe Lopinavir-Konzentration erforderlich, sagt Marzolini. Eine solche Dosierung wäre für den Patienten allerdings tödlich.
Ähnliche Verhältnisse beobachteten die Forscher für das Malariamedikament Hydroxychloroquin. Es kommt in der Lunge ebenfalls nicht in der Konzentration an, die für eine erfolgreiche Bekämpfung von Sars-CoV-2 erforderlich wäre. Der tiefere Grund hierfür ist die geringe Spezifität der beiden Medikamente, die ursprünglich für andere Krankheiten entwickelt wurden.
10. Juli: Wissenschafter fordern ein Frühwarnsystem für Zoonosen
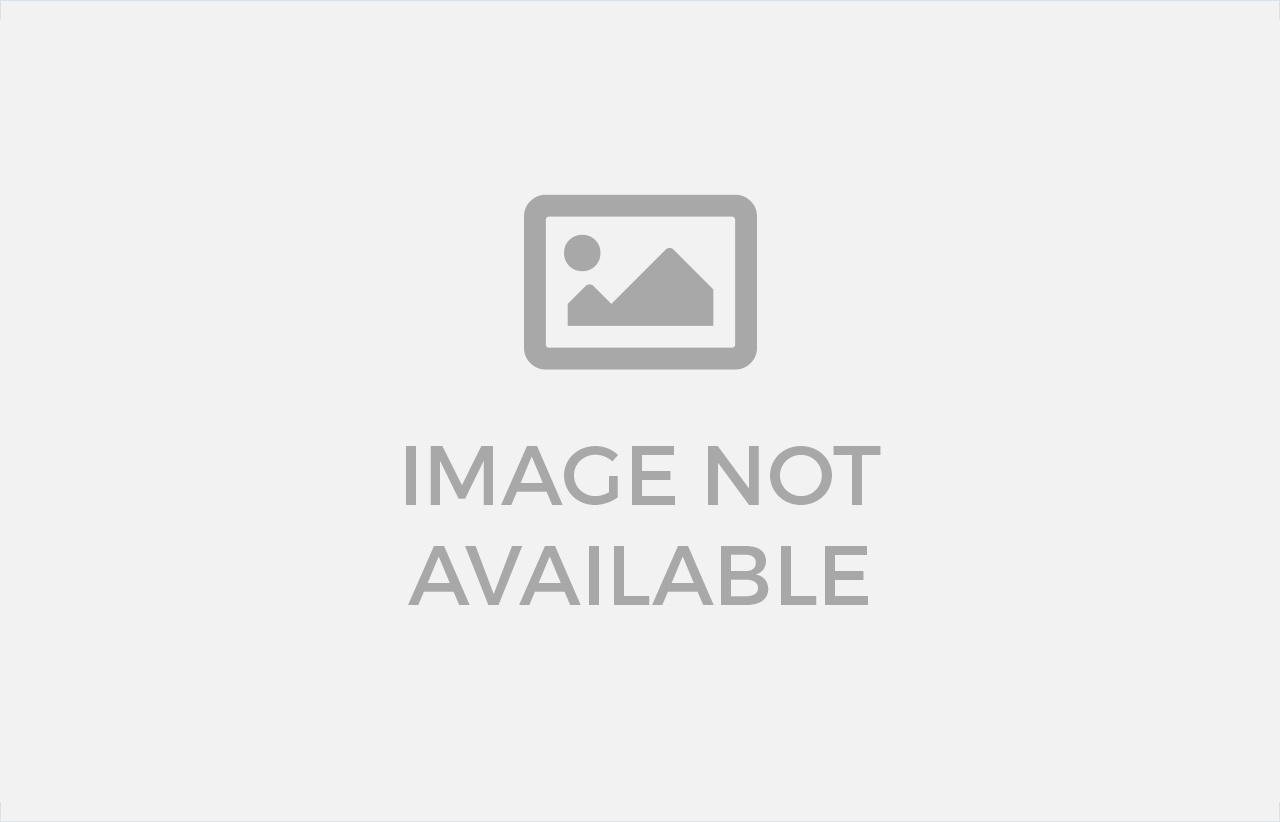
kus. · Eine internationale Gruppe von Wissenschaftern diskutiert in der wissenschaftlichen Fachzeitschrift «Science» ein Frühwarnsystem für Erreger, die von Tieren auf den Menschen überspringen könnten. Unter anderem fordern die Mitglieder der Wildlife Disease Surveillance Focus Group eine dezentrale, kontinuierliche Überwachung von Viren in Wildtieren, ein sogenanntes Monitoring. Die Überwachung vor Ort ermögliche lokalen Fachleuten, das ganze Jahr über Untersuchungen durchzuführen. Die Technologie hierfür existiere.
Kontrolliert werden sollten einerseits Tiere in der freien Natur, andererseits aber auch Tiere auf Wildtiermärkten. Letztere sind laut den Forschern nämlich oft in einem schlechten körperlichen Zustand, der sie empfänglicher für Krankheitserreger macht. Zudem leben sie unter unhygienischen Verhältnissen in engem Kontakt mit Spezies, auf die sie in der Natur nicht treffen würden – und mit dem Menschen. Diese Kombination von Faktoren bietet Erregern ein weites Spielfeld. Die Überwachung der Tierviren sollte zudem mit Testungsprogrammen bei Menschen ergänzt werden, um eventuell übergesprungene Viren frühzeitig zu finden.
Die Erkenntnisse aus den lokalen Monitoring-Programmen sollten dann in einer zentralen, kuratierten Datenbank zusammengetragen werden, wie die Wissenschafter schreiben. Auch hier nennen sie Beispiele, auf denen aufgebaut oder von denen Eigenschaften übernommen werden könnten. Zudem fordern sie einen internationalen Standard dazu, wie der Wildtierhandel unter Berücksichtigung von Krankheitsrisiken gehandhabt werden sollte.
9. Juli: Alt, männlich, krank, arm, nicht weiss: Das sind die wichtigsten Risikofaktoren für einen fatalen Covid-19-Verlauf
ni. · Ein britisches Forscherteam der University of Oxford hat die bisher grösste Covid-19-Kohorte auf Faktoren untersucht, die mit einem tödlichen Krankheitsverlauf einhergehen. Für ihre Analyse standen Ben Goldacre und seinen Kollegen die anonymisierten Krankengeschichten von mehr als 17 Millionen Erwachsenen in England zur Verfügung. Das entspricht 40 Prozent der im nationalen Gesundheitssystem (NHS) registrierten Personen. Knapp 11 000 der Krankengeschichten betrafen Patienten, die an Covid-19 gestorben waren. (In einer früheren Datenauswertung hatten den Forschern erst 5700 Krankengeschichten mit tödlichen Covid-19-Verläufen zur Verfügung gestanden.)
Wie bei anderen Studien stellte sich auch bei dieser Analyse ein fortgeschrittenes Alter als mit Abstand wichtigster Risikofaktor für einen fatalen Covid-19-Verlauf heraus. So war bei den über 80-Jährigen im Vergleich zu Personen zwischen 50 und 59 Jahren das Risiko, an der Infektion zu sterben, um das 20-Fache und mehr erhöht. Auch das männliche Geschlecht wirkte sich bei dieser Krankheit negativ aus. So war das Sterberisiko bei Männern um 60 Prozent höher als bei gleichaltrigen Frauen. Im gleichen Bereich lag auch das erhöhte Risiko für schwarze und asiatische Personen (gegenüber Weissen) und besonders für arme und benachteiligte Personen (gegenüber Bessergestellten).
Auch bei den Vorerkrankungen, die einen tödlichen Covid-19-Verlauf begünstigen, bestätigte sich das bisherige Bild. Neben starkem Übergewicht, Diabetes und chronischen Lungen-, Herz- und Lebererkrankungen waren nebst weiteren Faktoren auch neurologische Leiden und Autoimmunkrankheiten mit einem erhöhten Sterberisiko verbunden. Das bedeute aber nicht, dass all diese Störungen ursächlich für den Tod der Patienten verantwortlich seien, schreiben die Studienautoren. Der fatale Krankheitsverlauf könne auch auf einer Interaktion mit anderen klinischen Faktoren beruhen.
8. Juli: Experte fordert, schwangere Frauen als Risikogruppe einzustufen

slz. · «Schwangere sollten in der Schweiz unbedingt als Risikogruppe für Covid-19 eingestuft werden», fordert der Arzt und Molekularbiologe David Baud vom Universitätsspital Lausanne: Neue Daten aus Schweden, aber auch aus den USA zeigten, dass Schwangere ein etwas höheres Risiko für eine schwere Covid-19-Erkrankung aufwiesen als nicht schwangere Frauen. Das Bundesamt für Gesundheit und die Schweizerische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe sind laut eigenen Aussagen gerade dabei, die Richtlinien zu überarbeiten.
Über die Problematik haben wir in einem ausführlichen Artikel hier berichtet.
8. Juli: Das Immungedächtnis könnte doch besser sein als angenommen

slz. · Eine nach wie vor offene, aber enorm wichtige Frage für den weiteren Verlauf der Sars-CoV-2-Pandemie ist, wie lange von der Infektion Genesene gegen eine mögliche zweite Ansteckung geschützt sind. Jüngst mehrten sich entmutigende Hinweise vor allem für Personen, die nur eine leichte Infektion durchgemacht hatten. Denn die Menge ihrer gegen das Virus gerichteten Antikörper war oft gering und nahm zudem innert kurzer Zeit ab. Eine neue, noch nicht von Experten begutachtete Untersuchung aus Schweden macht nun aber doch Hoffnung auf einen länger anhaltenden Schutz auch für diese Personen.
Denn unser Immunsystem hat mehrere Pfeile im Köcher. So werden zusätzlich zu Antikörpern während der Erstinfektion mit einem Virus auch bestimmte Immunzellen gebildet, sogenannte T-Zellen, die von dem Erreger befallene Körperzellen erkennen und diese vernichten. Die schwedische Arbeitsgruppe hat nun gezeigt, dass unser Immunsystem gegen Sars-CoV-2 über mehrere Wochen hinweg stabile Gedächtnis-T-Zellen bildet.
Solche gegen Sars-CoV-2 spezifischen Gedächtnis-T-Zellen fanden sich auch im Körper von Genesenen, die nur eine sehr leichte Infektion durchgemacht hatten und kaum noch Antikörper gegen Sars-CoV-2 im Blut aufwiesen. Die gemessene T-Zell-Antwort entsprach laut den Autoren jener von erfolgreichen Impfungen gegen andere virale Erreger. Allerdings ist noch unklar, wie lange die für Sars-CoV-2 spezifischen T-Zellen überleben.
Auch für die Impfstoffentwicklung sind die neuen Erkenntnisse bedeutsam. Meist werden Vakzinkandidaten nur daraufhin getestet, ob ausreichend spezifisch gegen Sars-CoV-2 wirkende Antikörper gebildet werden. Zwar ist es deutlich aufwendiger, eine T-Zell-Antwort zu erfassen, doch laut Experten sollte man das unbedingt parallel überprüfen, um nur die wirklich wirksamen Vakzine weiterzuentwickeln.
6. Juli: Neandertaler-Gene könnten das Risiko eines schweren Covid-Verlaufs erhöhen
kus. · Man kennt eine Reihe von Faktoren, die das Risiko eines schweren Covid-19-Verlaufs erhöhen, darunter ein hohes Alter oder Herz-Kreislauf-Vorerkrankungen. Auch im Erbgut konnten Forscher bereits DNA-Sequenzen ausfindig machen, die bei Patienten mit schweren Verläufen häufiger sind. Eine solche hat ein internationales Team von Wissenschaftern etwa auf dem Chromosom 3 des Menschen gefunden. Sie kam häufiger bei Personen vor, die künstlich beatmet werden mussten, als bei solchen, die nur zusätzlichen Sauerstoff benötigten.
Es ist eine ganz bestimmte Variante dieser Sequenz, die mit einem erhöhten Risiko für eine schwere Form von Covid-19 verknüpft ist – und diese Variante stammt vom Neandertaler. Zu diesem Schluss kommen Svante Pääbo und Hugo Zeberg vom Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig bei einer Analyse der Sequenz, die sie vorab, ohne Begutachtung durch Fachkollegen, auf dem Preprint-Server «BioRxiv» veröffentlicht haben. Am ähnlichsten war die Erbgutsequenz jener eines Neandertalers, der vor etwa 50 000 Jahren im heutigen Kroatien lebte. Sequenzen sibirischer Neandertaler glichen ihr weniger, wie die Forscher schreiben.
Die Neandertalersequenz komme in verschiedenen Regionen unterschiedlich häufig vor, heisst es weiter: in Europa beispielsweise mit einer Frequenz von 8 Prozent oder in Südasien mit einer von 30 Prozent. In Bangladesh besitzen gar über 60 Prozent der Bevölkerung mindestens eine Kopie der Risikovariante. Die Sequenz umfasst sechs Gene, die unter anderem mit dem Immunsystem und dem Rezeptor in Verbindung stehen, über den das neue Coronavirus in die Zellen gelangt. Welche davon möglicherweise zu einem erhöhten Risiko beitragen und wie, ist bis anhin unklar.
Dass sich moderner Mensch und Neandertaler vor etwa 50 000 Jahren vermischten, weiss man schon länger; die ein bis zwei Prozent Neandertaler-Erbgut, die sich im Genom heutiger Europäer finden, zeugen davon. Die Erbgutsequenz auf Chromosom 3 ist auch nicht die erste, die mit Krankheiten in Verbindung gebracht wird. So soll ein Neandertaler-Gen beispielsweise auch das Risiko erhöhen, einen Diabetes Typ 2 zu entwickeln.
2. Juli: Die Lunge von Covid-19-Patienten durchläuft zwei Stadien

ni. · Mit einer Autopsie können Ärzte ihre zu Lebzeiten des Patienten gestellten Diagnosen überprüfen. Bei einer neuen Krankheit wie Covid-19 kann die Leichenöffnung zudem einen wichtigen Beitrag zum Verständnis der Krankheit liefern. Anders als bei der klassischen Autopsie, bei der das Gewebe von Auge und unter dem Mikroskop betrachtet wird, geht die molekulare Autopsie einen Schritt weiter. Mithilfe von modernsten Analyseverfahren liefert sie einen Einblick in die molekularbiologischen Mechanismen von Krankheiten.
Eine solche molekulare Autopsie hat eine Schweizer Forschergruppe an 16 Personen durchgeführt. Sie alle waren in den Kantonen Basel-Landschaft und Basel-Stadt an Covid-19 gestorben. Die Wissenschafter interessierten sich für die in den Lungen abgelaufene Immunantwort gegen Sars-CoV-2. Diese charakterisierten sie anhand von Parametern wie der Anzahl Viren im Organ, der Zahl der Entzündungszellen und anhand davon, welche Genabschnitte bei den Zellen abgelesen wurden. Diese Daten setzten sie in Bezug zu klinischen Parametern wie dem Krankheitsverlauf.
So konnten die Forscher bei den Leichen zwei immunologische Signaturen in den Lungen nachweisen, die bei schwerem Covid-19-Verlauf nacheinander auftreten. So ist das Organ in der ersten Phase stark vom Virus besiedelt, das Gewebe aber noch weitgehend intakt. In dieser Phase sind die molekularen Entzündungsparameter stark erhöht. Sie klingen später aber wieder ab. In dieser zweiten Phase scheint das Virus zwar kontrolliert, doch das Lungengewebe zeigt jetzt Zeichen der Zerstörung sowie Ablagerungen von Proteinen des sogenannten Komplementsystems.
Ihre Befunde hätten Implikationen für die Behandlung von Covid-19-Patienten, schreiben die Studienautoren. So stünden in der ersten Phase der Immunantwort gegen das neue Coronavirus antivirale Medikamente wie Remdesivir und breit wirksame Entzündungshemmer im Vordergrund. Später könnten dann Arzneimittel hilfreich sein, die die Aktivität von Komplement-Eiweissstoffen hemmten.
29. Juni: War das neue Coronavirus schon im März 2019 in Barcelona?

ni. · Nein, das ist kein Schreibfehler. Auf einzelnen Medienportalen ist derzeit zu lesen, dass spanische Forscher das neue Coronavirus Sars-CoV-2 schon im März 2019 im Abwasser von Barcelona nachgewiesen haben wollen. Das gibt der populären Hypothese Auftrieb, wonach das Virus schon Monate vor den ersten bekannten Infektionsfällen – diese traten nach offizieller Darstellung im Dezember 2019 in Wuhan, China, auf – in der menschlichen Population zirkuliert haben könnte. Die jüngsten Berichte beziehen sich auf eine Studie von Wissenschaftern der University of Barcelona. Ihre Arbeit ist bereits am 13. Juni auf dem Preprint-Server medRxiv erschienen, hat bisher aber für wenig Aufsehen gesorgt.
Die Forschergruppe von Albert Bosch hat in zwei Kläranlagen in Barcelona nach dem neuen Krankheitserreger gesucht. In einem ersten Schritt haben sie wöchentliche Wasserproben analysiert, um die Entwicklung der Covid-19-Pandemie in der Grossstadt nachzuzeichnen. Denn auch wenn der Ansteckungsweg bei diesem Virus hauptsächlich über die Atemwege führt, wird es auch mit dem Stuhl ausgeschieden. Die Spur des Erregers sollte sich daher auch im Abwasser finden lassen.
Tatsächlich konnten die Forscher zeigen, dass die im Abwasser gefundenen Mengen an Sars-CoV-2-Erbgut mit dem im Frühling in der Stadt einsetzenden Rückgang der Fallzahlen parallel verliefen. In einem zweiten Schritt untersuchten sie dann auch noch aufbewahrte Wasserproben, auch solche aus dem Jahr 2019. Und da machten sie zwei unerwartete Funde. Zum einen liess sich das Virus im Abwasser der Kläranlagen schon 41 Tage vor dem ersten offiziellen Infektionsfall in Barcelona nachweisen; dieser stammt vom 25. Februar 2020. Zum andern – und das ist das Spektakuläre der Studie – fanden die Forscher in einer Wasserprobe vom 12. März 2019 Genomsequenzen, die auf die Präsenz von Sars-CoV-2 hindeuten sollen. Laut den Studienautoren zeigt das erstaunliche Ergebnis, dass das Virus schon lange vor den ersten Berichten über die weltweit ersten Covid-19-Fälle in Barcelona zirkulierte.
Aufgrund dieses einen Ergebnisses auf das Vorhandensein des Virus im März 2019 in Barcelona zu schliessen, ist einigen Kommentatoren der Studie jedoch zu früh. Auch die Virologin Isabella Eckerle von der Universität Genf äussert sich in einem Tweet sehr skeptisch: Für einen Beweis müsste schon die (oder zumindest eine Teil-)Sequenz des Virus vorgelegt werden. Nur so könne man anhand von phylogenetischen Analysen zeigen, dass es sich dabei um eine frühe Variante von Sars-CoV-2 handle, so Eckerle.
Andere Forscher weisen darauf hin, dass in der Probe vom 12. März 2019 nicht Sars-CoV-2 nachgewiesen wurde, sondern lediglich zwei Genomabschnitte (von mehreren gesuchten), die auf Sars-CoV-2 hindeuten könnten. Interessanterweise liessen sich diese beiden Erbgutschnipsel weder in früheren noch in späteren Wasserproben der Kläranlage finden. Ein Forscher schreibt dazu in seinem Kommentar, dass auch eine Kontamination im Labor zu dem Ergebnis geführt haben könnte.
30. Juni: Das HIV-Mittel Lopinavir-Ritonavir ist bei Covid-19 nutzlos

ni. · Wie andere Substanzen gehörte das bei HIV-Patienten eingesetzte Kombinationspräparat Lopinavir-Ritonavir seit Beginn der Corona-Pandemie zu den Hoffnungsträgern bei der Behandlung von schwer erkrankten Covid-19-Patienten. Diese Hoffnung hat sich nun zerschlagen. Wie ein Sprecher der britischen Recovery-Studie am Montag in einer Medienmitteilung schreibt, hat sich bei der Überprüfung der Substanz kein klinischer Nutzen für die Behandelten ergeben.
In der drei Monate dauernden Evaluationsstudie waren 1596 Covid-19-Patienten – zusätzlich zur üblichen Therapie – mit dem HIV-Medikament behandelt worden. Bei der Berechnung der Mortalitätsrate nach 28 Tagen zeigte sich kein statistisch signifikanter Unterschied zur Vergleichsgruppe von 3376 Patienten, die das Mittel nicht bekommen hatten. In beiden Gruppen waren gut 20 Prozent der Personen nach dieser Zeit gestorben.
Laut der Mitteilung der University of Oxford hatte das Medikament auch keinen günstigen Einfluss auf das Risiko der Patienten, eine künstliche Beatmung zu benötigen. Damit hat die Recovery-Studie nach dem von Präsident Trump als Wundermittel angepriesenen Malariamittel Hydroxychloroquin schon den zweiten medikamentösen Hoffnungsträger bei Covid-19 zu Grabe getragen. Bei einer anderen Substanz, Dexamethason, die zu Beginn nur wenige auf dem Schirm hatten, ist allerdings das Gegenteil passiert: Die Studie konnte nachweisen, dass sich damit bei Schwerkranken Leben retten lassen.
25. Juni: Covid-19 im globalen Süden: Jung, aber häufig vorerkrankt

rtz. · In den Industrieländern wird eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus vor allem für Menschen jenseits des Pensionsalters gefährlich: Sie sind es, die am ehesten schwere Verläufe durchmachen oder dem Virus erliegen. Deswegen, so lautete eine in den letzten Wochen häufig wiederholte These, könnte der globale Süden trotz vergleichsweise schlechterer medizinischer Versorgung weniger hart von der Pandemie getroffen werden. Denn die Bevölkerungen Afrikas, Südamerikas und Südostasiens seien so jung, dass dort mit einer noch höheren Anzahl milder Verläufe und einer entsprechend niedrigeren Quote schwerer Erkrankungen und Todesfälle zu rechnen sei.
Dem widerspricht nun eine Studie von Forschern des Max-Planck-Instituts für demografische Forschung in Rostock, Deutschland. Die Menschen in Ländern des globalen Südens seien nicht weniger von der Pandemie betroffen, wenngleich die Bevölkerung dort im Durchschnitt jünger sei, schreiben die Forscher. Dies, weil der Anteil der Menschen im Erwerbsalter mit Vorerkrankungen dort deutlich höher ist als in Europa.
Laut der Studie, für die Marilia Nepomuceno und ihre Kollegen Daten der Global Burden of Disease Database ausgewertet haben, leiden in Brasilien und Nigeria Erwachsene in fast jedem Alter häufiger an Vorerkrankungen als in Italien. Damit steigt auch ihr Risiko für einen schweren Verlauf von Covid-19. Bei den Menschen Anfang 20 in Brasilien und Nigeria liegt der Anteil derjenigen, die an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung leiden, mehr als zwei Mal so hoch wie in Italien. Auch bei chronischem Nierenversagen und der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) ist die Prävalenz, also der Anteil der Erkrankten in der Bevölkerung, in Brasilien und Nigeria bei Menschen über 40 Jahren im Vergleich zu Italien deutlich höher. Bei Frauen in Nigeria können die Unterschiede in der Prävalenz sogar bis zu viermal so hoch sein wie in Italien.
Es sei deshalb anzunehmen, dass dort die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter weitaus anfälliger für schwere Formen von Covid-19 sei als in Europa, schliessen Nepomuceno und ihre Kollegen. Die Arbeit erscheint in den «Proceedings of the National Academy of Sciences» (PNAS).
23. Juni: Machen Mutationen das Coronavirus gefährlicher?
rtz. · Die zurzeit zirkulierenden Coronaviren unterscheiden sich im Erbgut jeweils an etwa 10 bis 15 Stellen von denjenigen, die zu Anfang der Pandemie auftauchten. Eine davon könnte das Virus möglicherweise leichter übertragbar machen. Warum man sich deswegen vorerst keine Sorgen machen muss, erklärt unsere Wissenschaftsredaktorin Stephanie Kusma in einem separaten Artikel.
22. Juni: Wann kommt die befürchtete «zweite Welle»?
rtz. · Abermals befasst sich eine Studie mit der Frage, wie schnell nach der Aufhebung von strikten Massnahmen der sozialen Distanz ein Wiederanstieg der Fallzahlen zu erwarten ist. Leonardo López und Xavier Rodó vom Barcelona Institute for Global Health haben dazu verschiedene Szenarien modelliert (es handelt sich um ein modifiziertes SEIR-Modell); die Ergebnisse erscheinen in der jüngsten Ausgabe von «nature human behaviour». Die Forscher fokussieren auf die Dynamik der Covid-19-Epidemie in Spanien, vergleichen ihre Ergebnisse aber auch mit den Verläufen in Neuseeland, Japan, den USA und anderen Ländern.
Die Ergebnisse der Forscher legen nahe, dass eine zweite Welle umso früher eintritt, je kürzer ein strikter Lockdown durchgehalten wird. Bei einem 30-tägigen Lockdown prognostiziert die Simulation bereits für die zweite Julihälfte einen erneuten, rapiden Anstieg der Infektionszahlen. Bleiben die Massnahmen für 60 Tage in Kraft, verzögert sich die zweite Welle bis in den September. Nach einem 90-tägigen Lockdown wäre ein erneuter Anstieg der Infektionszahlen sogar erst Anfang Dezember zu erwarten. Dies jeweils für den Fall, dass alle einschränkenden Massnahmen am Ende des Lockdowns gleichzeitig aufgehoben werden und dass diese Regelungen für alle Bevölkerungsgruppen gleichermassen gelten.
Dies verglichen die Forscher mit modifizierten Strategien, bei denen die Bevölkerung nach und nach aus dem Lockdown entlassen wird beziehungsweise besonders gefährdete Menschen länger an die Schutzmassnahmen gebunden bleiben. Beide Strategien verringerten die zu erwartende Anzahl Infizierter und Toter.
19. Juni: Abwasser als Frühwarnsystem für Sars-CoV-2
rtz. · In Abwasserproben aus Turin, Mailand und Bologna haben Forschende das neuartige Coronavirus nachgewiesen. Das teilt das Instituto Superiore di Sanità in Rom mit. Die frühesten Proben, die das Virus enthalten, wurden demnach in Turin und Mailand am 18. Dezember 2019 entnommen; die älteste mit dem Virus belastete Probe aus Bologna stammt vom 29. Januar 2020. Damit ist ein weiterer Nachweis dafür erbracht, dass das Virus keineswegs erst Anfang Jahr nach Oberitalien eingeschleppt wurde, sondern bereits einige Wochen früher dort zirkulierte. Dies hatten Wissenschafter bereits vermutet, insbesondere weil gegen Ende des Jahres 2019 in der Region eine ungewöhnliche Häufung von schlimmen Lungenentzündungen beobachtet wurde. Doch war damals von einem neuen Virus noch nicht die Rede, geschweige denn ein präziser Test verfügbar. Die nun untersuchten Abwasserproben wurden im Rahmen von regelmässigen, standardisierten Kontrolluntersuchungen genommen, wie es sie überall gibt.
Ähnliche Ergebnisse liegen aus Frankreich, aus Spanien und den Niederlanden, aber auch aus der Schweiz vor: Forscher der Empa haben in Abwasserproben aus Lugano und Zürich eine Belastung mit Sars-CoV-2 nachweisen können, und zwar beginnend mit Proben, die schon Ende Februar genommen wurden. Damals war in Lugano nur ein einziger Infektionsfall bekannt, in Zürich gab es dazumal 6 Fälle.
Die Ergebnisse sind nicht nur rückblickend interessant. Vielmehr beabsichtigen die Forscher, auf der Basis engmaschiger Probenentnahmen aus dem Abwasser und effizienter Analyseverfahren ein Frühwarnsystem für die Ausbreitung von Sars-CoV-2 aufzubauen. Mit diesem könnten allfällige regionale Ausbrüche rasch entdeckt und entsprechend gegengesteuert werden.
Übrigens: Dass das Virus im Abwasser gefunden wurde, bedeutet keineswegs, dass eine Ansteckung via Trinkwasser möglich ist. Denn die Viren, die die Forscher im Abwasser dingfest machen, sind bereits tot.
17. Juni: Wie anfällig sind Kinder?
rtz. · Abermals kommt eine Studie zu dem Ergebnis, Kinder seien – anders als bei anderen Infektionskrankheiten – nicht die Treiber der Epidemie. Forscher von vier Spitälern in Süddeutschland haben untersucht, wie viele Kinder und Eltern aus einer Stichprobe von 5000 Personen Antikörper gegen Sars-CoV-2 gebildet haben. Entsprechende Antikörper wurden lediglich bei 45 Erwachsenen und 19 Kindern gefunden.
Eine abschliessende Antwort auf die Frage, welche Rolle Kinder bei der Übertragung und Verbreitung des neuartigen Coronavirus spielen – und ob die Öffnung von Schulen und Kindergärten weitgehend gefahrlos möglich ist –, ist damit aber immer noch nicht gegeben. Warum, haben wir hier ausführlich erläutert.
16. Juni: Ein altbekanntes Medikament weckt neue Hoffnungen

rtz. · In Oxford wurden mit dem Medikament Dexamethason beachtliche Behandlungserfolge bei schwerkranken Covid-19-Patienten erzielt. Das weckt Hoffnungen, insbesondere weil es sich bei dem Medikament um ein äusserst günstiges, lange bewährtes Cortisonpräparat handelt. Damit kommt es auch für die Behandlung von Patienten in armen oder weniger wohlhabenden Ländern infrage.
Über diese Ergebnisse haben wir in einem separaten Artikel berichtet.
15. Juni: Nur 11 Prozent der Genfer haben sich infiziert
lsl. · Das wahre Ausmass der Covid-19-Pandemie ist schwer abzuschätzen, denn viele der Infizierten haben sich nie testen lassen. Um den Verlauf der Epidemie dennoch nachvollziehen zu können, haben Forscher im Kanton Genf breitflächige Antikörpertests durchgeführt. Die Ergebnisse haben sie in der Zeitschrift «The Lancet» publiziert.
Im Blut von fast 2800 zufällig ausgewählten Personen haben die Forscher über fünf Wochen hinweg nach Antikörpern gesucht. Diese Moleküle werden im Körper gebildet, um das Virus abzuwehren, und lassen sich auch mehrere Wochen nach einer Infektion noch nachweisen.
Im Verlauf der Studie nahm der Anteil der Personen, die Antikörper aufwiesen, zu: von 5 Prozent der getesteten Personen in der Woche vom 6. April auf 11 Prozent in der letzten Woche, jener vom 9. Mai. Bei Kindern und älteren Menschen über 65 Jahren fiel das Ergebnis seltener positiv aus. Entweder steckten sie sich weniger häufig an – was bei den alten Menschen auf effektive Schutzmassnahmen zurückzuführen sein könnte – oder sie bildeten seltener Antikörper.
Das bedeutet, dass sich sogar in einem so stark betroffenen Kanton wie Genf nur jeder zehnte Einwohner mit dem Virus angesteckt hat. Zum Vergleich: Mit den gängigen Virustests gab es in Genf auf 10 000 Einwohner 104 positiv Getestete, 35 waren es in der ganzen Schweiz, 44 in Grossbritannien und 63 in den USA (Stand 15. Juni, Quelle: corona-data.ch). Der Kanton Genf gehört demnach zu den am stärksten betroffenen Regionen weltweit.
In einer anderen Publikation in der Zeitschrift «Nature» hat eine Forschergruppe anhand der Todesfälle in Europa berechnet, dass sich zwischen 3,2 und 4 Prozent der Bevölkerung mit dem Virus infiziert haben – mit starken regionalen Schwankungen.
Damit dürfte nach der ersten Infektionswelle auch erst ein kleiner Teil der Bevölkerung immun gegen eine erneute Infektion sein. Wobei noch nicht klar ist, wie lange die Immunität im Fall von Sars-CoV-2 überhaupt anhält.
12. Juni: Viele haben im Lockdown mehr, aber schlechter geschlafen
ni. · Bis zu 50 Minuten länger haben Personen während des Lockdowns geschlafen. Das zeigt eine Studie der Universität Basel und der Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel. Für ihre Arbeit haben Christine Blume und ihre Forscherkollegen 430 Personen in der Schweiz, Deutschland und Österreich befragt. Da die Probanden zwei Fragebögen ausfüllten – einen für die Zeit vor und einen für die Zeit nach dem Shutdown in ihrem Land –, ähnelt die Untersuchung einem medizinischen Experiment.
Mit der sechs Wochen im März und April abdeckenden Studie wollten die Forscher – zu ihnen zählt auch der Basler Chronobiologe Christian Cajochen – herausfinden, wie sich der Lockdown auf die Schlafdauer und die Schlafqualität der Menschen auswirkte. Fachleute gehen davon aus, dass viele Schlafstörungen das Resultat unseres modernen Lebensstils sind. Dabei diktiert nicht die auf das Sonnenlicht ausgerichtete innere biologische Uhr unsere Schlaf- und Wachphasen, sondern der hektische Arbeitsrhythmus und das Freizeitverhalten. Ist die Diskrepanz zwischen diesen beiden Taktgebern gross, kommt es zu einer Art dauerhaftem Jetlag, was nachweislich die körperliche und geistige Gesundheit schädigt.
Im Lockdown arbeiteten über 85 Prozent der Teilnehmer der Basler Studie im Home-Office. Bei ihnen fiel nicht nur der Arbeitsweg weg. Sie dürften auch ihre Arbeitszeiten flexibler gestaltet haben können. Dadurch sollte sich der sogenannte soziale Jetlag – dieser bemisst sich am Unterschied in der Schlafenszeit und der Schlafdauer zwischen den Arbeitstagen und den freien Tagen – verringert haben. Diesen Effekt konnten die Forscher tatsächlich nachweisen. So reduzierte sich bei den Befragten während des Lockdowns der Unterschied bei der Schlafenszeit (zwischen Werktagen und Freitagen) um durchschnittlich 13 Minuten; bei der Schlafdauer verringerte sich der Unterschied um 25 Minuten.
Wie die Analyse weiter zeigt, schliefen die Befragten während des Lockdowns täglich um durchschnittlich 13 Minuten länger als zuvor; einzelne Probanden schliefen sogar bis zu 51 Minuten länger. Trotzdem führte das Mehr an Schlaf nicht zu einer Verbesserung der wahrgenommenen Schlafqualität. Im Gegenteil: Die Befragten beurteilten ihre Schlafqualität während des Lockdowns sogar als etwas schlechter als in den Wochen zuvor. Wie die Basler Forscher schreiben, dürfte das damit zusammenhängen, dass die Corona-Krise und der damit verbundene Lockdown für die Befragten in vielerlei Hinsicht belastend gewesen ist.
Die Forscher räumen ein, dass ihre Studienergebnisse nicht eins zu eins generalisierbar seien. So waren zum Beispiel drei Viertel der Befragten Frauen. Die meisten Probanden waren zudem eher gut ausgebildete Personen, die insgesamt keine grösseren Schlafprobleme hatten. Gerade letztere Faktoren dürften dazu geführt haben, dass der positive Effekt von flexibleren Arbeitszeiten in der Studie eher unter- denn überschätzt würde, so die Forscher. Am meisten vom Home-Office profitieren dürften die sogenannten späten Chronotypen, also Personen, deren biologische Uhr ein vergleichsweise spätes Aufstehen erfordert.
10. Juni: Traten die ersten Covid-19-Fälle schon im Herbst in Wuhan auf?

ni. · Nach verschiedenen Studien sind die ersten Fälle von Covid-19 in Wuhan, China, Ende November oder Anfang Dezember aufgetreten. Gleichzeitig gibt es aber auch Hinweise darauf, dass das neue Coronavirus schon Wochen oder Monate früher in Südchina zirkuliert haben könnte. Diese Ansicht vertritt nun auch eine amerikanische Forschergruppe der Harvard Medical School in Boston. Für ihre Untersuchung haben John Brownstein und seine Kollegen anhand von Satellitenaufnahmen die Parkplatzbelegung von sechs Spitälern in Wuhan sowie die aus dieser Gegend stammenden Internetanfragen nach Begriffen wie «Husten» und «Durchfall» analysiert.
Obwohl die Parkplatzbelegung der Kliniken zwischen 2018 und 2020 generell zugenommen hat, liess sich laut den Forschern in den über 100 Satellitenbildern ab August 2019 ein starker Anstieg nachweisen. Fünf der sechs Spitäler erlebten zwischen September und Oktober ein besonders grosses Besucheraufkommen. In dieser Zeit verzeichnete die chinesische Suchmaschine Baidu einen deutlichen Anstieg bei den Suchanfragen nach «Husten» und «Durchfall». Der Begriff «Durchfall» sei dabei besonders interessant, schreiben die Forscher. Denn dieser sei spezifischer für Covid-19 als «Husten», der parallel zur Grippesaison jährliche Peaks zeige.
Auch wenn die Befunde mit einem frühzeitigen Auftreten von Sars-CoV-2 im Herbst 2019 vereinbar sind: Ein Beweis sind sie nicht, das schreiben auch die Autoren der Studie. Eindeutiger wäre die Situation, wenn im Nachhinein noch der Virusnachweis bei Spitalpatienten gelänge, die im Spätsommer oder Herbst 2019 wegen unklaren respiratorischen Symptomen in Wuhan hospitalisiert waren. Dass das möglich ist, hat der Fall eines Patienten in Frankreich gezeigt. Dafür muss im Spital aber noch biologisches Material wie Auswurfsekret oder Blut für eine Nachuntersuchung gelagert sein.
9. Juni: Weitere Hinweise für die Wirksamkeit von Remdesivir

ni. · Das ursprünglich gegen Ebola entwickelte Medikament Remdesivir gehört seit Beginn der Corona-Pandemie zu den vielversprechendsten Therapien für Patienten mit Covid-19. Nach positiven Ergebnissen in klinischen Studien erteilten die USA bereits Anfang Mai eine Ausnahmebewilligung für den Einsatz der Substanz in Spitälern. Die amerikanische Herstellerfirma Gilead hat inzwischen auch eine Zulassung in der Europäischen Union beantragt, wie die europäische Arzneimittelbehörde (EMA) am Montag mitteilte.
Von Remdesivir ist der grösste Nutzen dann zu erwarten, wenn das Mittel möglichst früh im Krankheitsverlauf verabreicht wird. Welchen Effekt es dann erzielen kann, haben Forscher der amerikanischen National Institutes of Health in Hamilton bei Rhesusaffen untersucht. Im Gegensatz zu unbehandelten Tieren entwickelten Rhesusaffen, die 12 Stunden nach der Infektion mit Sars-CoV-2 Remdesivir erhalten hatten, deutlich weniger Schäden in ihren Lungen. Dieses Ergebnis ging mit einem weiteren Befund einher: Bei den behandelten Affen liess sich im tiefen Atemtrakt nur ein Hundertstel der Coronaviren verglichen mit den unbehandelten Tieren nachweisen.
Ihre Ergebnisse unterstützten eine frühzeitige Behandlung von Covid-19-Patienten mit Remdesivir, schreiben Emmie de Wit und ihre Forscherkollegen in ihrem Artikel. Ein Wermutstropfen bleibt allerdings: Trotz der klinischen Verbesserung liess sich bei den behandelten Tieren keine Reduktion der Virusausscheidung nachweisen. Das bedeutet, dass die Therapie mit Remdesivir keinen grossen Einfluss auf die Infektiosität des Individuums haben dürfte.
8. Juni: Schützt die Tuberkulose-Impfung vor Covid-19?

ni. · Seit längerem wird darüber diskutiert, ob die seit Jahrzehnten verwendete Impfung gegen Tuberkulose (BCG) auch vor Covid-19 schützt. Die Idee ist nicht abwegig, gibt es doch wissenschaftliche Evidenz, dass mit BCG geimpfte Personen auch einen gewissen Schutz vor verschiedenen Infektionskrankheiten haben. Fachleute führen dieses Phänomen auf eine unspezifische Wirkung der Vakzine zurück, die vor allem den angeborenen Teil des Immunsystems gegen Eindringlinge stärken soll.
Um den Nutzen der Tuberkulose-Impfung gegen Sars-CoV-2 abzuklären, griff David Levine von der University of California in Berkeley, USA, zu einem Trick. Er verglich die Daten über die bestätigten Covid-19-Fälle und die Covid-19-Sterberaten in Spanien und in Italien. Der Wissenschafter wählte diese beiden Länder für seine Analyse, weil sie sich bei der Häufigkeit der Tuberkulose-Impfung stark unterscheiden. Während Spanien bis 1981 ein nationales BCG-Impfprogramm für alle Bürger betrieb, wurden in Italien nur wenige Risikopersonen geimpft. In anderer Hinsicht wie der Lebenserwartung, der Altersverteilung oder der Häufigkeit von Risikofaktoren wie Diabetes oder Übergewicht seien sich die Länder dagegen sehr ähnlich, so Levine.
Die Analyse, die erst als wissenschaftlich noch nicht begutachteter Preprint vorliegt, zeigt nun folgendes Bild: Vergleicht man die Covid-19-Fallzahlen und -Mortalitätsraten bei Personen, die vor und nach dem Stopp des nationalen BCG-Impfprogramms in Spanien geboren wurden (41- bis 49-Jährige bzw. 31- bis 39-Jährige), scheinen die älteren Semester in Spanien besser mit dem Coronavirus zurechtgekommen zu sein als ihre Altersgenossen in Italien. Das spreche für einen «Fetzen von Evidenz», dass die BCG-Impfung vor einer Covid-19-Erkrankung schützen könnte, schreibt Levine.
Die vorsichtige Formulierung ist mit Bedacht gewählt. Denn erstens ist nur das Resultat bezüglich der Covid-19-Fallzahlen statistisch signifikant; bei der Mortalität liegt dagegen nur ein statistischer Trend für eine Reduktion vor. Zweitens fällt die nachgewiesene Risikoreduktion bei den Covid-19-Zahlen mit 3,8 Prozent (relativer Risikoreduktion) in Spanien minimal aus. Und drittens gibt es viele möglichen Störfaktoren wie zum Beispiel eine in Spanien und Italien unterschiedlich gute Entdeckung und Meldung von Corona-Fällen, die die Ergebnisse verfälscht haben könnte.
5. Juni: Zwei prominente Studien zurückgezogen
rtz. · Zwei prominente Studien zur Behandlung von Covid-19-Patienten erweisen sich als völlig unseriös. Das Problem: Die Daten für die beiden Studien stammten von der Firma Surgisphere; diese hielten aber einer Überprüfung nicht stand. Über die Studien und ihre Datengrundlage haben wir hier ausführlich berichtet, Medizinredaktor Alan Niederer hat den Forschungsskandal ausserdem kommentiert.
4. Juni: Strategien zur Reduktion von Kontakten

kus. · Der erste Höhepunkt der Covid-19-Pandemie in der Schweiz ist vorbei, und die Massnahmen zur Abflachung der Infektionskurve werden zunehmend gelockert. Dabei soll die Zahl der Neuinfektionen trotzdem möglichst niedrig und die Kurve flach gehalten werden. Hierfür braucht es sinnvolle Massnahmen, denn komplett wieder zu einer Normalität zurückzukehren, wie sie vor Beginn der Pandemie herrschte, birgt stets die Gefahr einer zweiten Infektionswelle. Forschende aus England und der Schweiz haben nun modelliert, wie sich verschiedene Strategien zur Reduktion von Kontakten auf die Infektionskurve auswirken.
Sie untersuchten drei Strategien, wie sie in der wissenschaftlichen Fachzeitschrift «Nature Human Behaviour» beschreiben: Im ersten Szenario haben nur Personen miteinander Kontakt, die wichtige Charakteristika teilen, etwa in der gleichen Nachbarschaft leben. Hier ist es laut den Forschern wichtig, dass die Attribute so gewählt sind, dass die Gruppen nicht zu gross werden. Die zweite Strategie zielt darauf ab, möglichst nur mit solchen Personen persönlichen Kontakt zu haben, die untereinander ebenfalls in Verbindung stehen. Das hiesse beispielsweise, dass ein geschlossener Freundeskreis untereinander den Kontakt hält, aber persönliche Kontakte mit Freunden ausserhalb dieses Kreises meidet. Im dritten Szenario schliesslich wird strategisch ein Netzwerk aus «sinnvollen» Kontakten gebildet, das ausschliesslich untereinander Kontakt hat. Das kann einerseits bei der Arbeit sein, aber andererseits auch die Entscheidung betreffen, welches Familienmitglied den Kontakt zu einer gefährdeten älteren Person hält.
Diese drei Szenarien (mit einer Kontaktreduktion um jeweils 50 Prozent) verglichen sie dann einerseits mit einem, in dem Personen unlimitiert Kontakt zueinander hatten, und einem weiteren, bei dem Kontakte nicht strategisch, sondern ungerichtet um die Hälfte eingeschränkt wurden. Wie sich zeigte, flachten die drei strategischen Interventionen die Kurve am deutlichsten ab, und das auch dann, wenn sie miteinander kombiniert wurden. Dieses Resultat blieb zudem erhalten, wenn die Forscher Faktoren wie die Infektiosität des Virus oder die Menge der Personen änderten. Letztere war aufgrund der Rechenkapazität der Computer auf 4000 beschränkt.
Die Forscher schliessen hieraus, dass drei verhältnismässig einfache Verhaltensmassnahmen – das Suchen von Gemeinsamkeiten, die Stärkung von Interaktionen innerhalb bestehender Gemeinschaften und wiederholte Kontakte mit immer denselben Personen – dazu beitragen können, die Infektionskurve flach zu halten.
3. Juni: Reproduktionsrate in der Schweiz
Spe. · Durch ein Bündel von Massnahmen ist es der Schweiz in den letzten Wochen gelungen, die Corona-Epidemie in den Griff zu bekommen. Aber immer noch ist unklar, welche Einschränkungen dabei eine Schlüsselrolle gespielt haben. Auf der Suche nach einer Antwort haben Forscher der EPFL modelliert, wie sich die Reproduktionszahl seit Ende Februar entwickelt hat. Die Gruppe von Jacques Fellay stützt sich dabei auf öffentlich zugängliche Daten zur Hospitalisierung von Covid-19-Patienten und zu Todesfällen.
Die Reproduktionszahl gibt an, wie viele Menschen ein Infizierter im Durchschnitt ansteckt. Laut den Forschern sank diese Zahl von 2,8 Ende Februar auf 0,4 Anfang April. Das entspricht einer Reduktion um 86 Prozent. Aus der Modellierung geht hervor, dass der Rückgang bereits am 6. März begann – also vor den Schulschliessungen und bevor der Bundesrat eine Schliessung von Geschäften, Bars und Restaurants anordnete. Als am 20. März Versammlungen mit mehr als fünf Personen verboten wurden, habe die Reproduktionszahl mit grosser Wahrscheinlichkeit bereits unter der kritischen Schwelle von 1 gelegen, schreiben die Forscher im «Swiss Medical Weekly». Das deckt sich mit früheren Modellierungen von Tanja Stadler von der ETH Zürich in Basel.
Die Forscher warnen allerdings davor, deshalb das Versammlungsverbot oder andere Massnahmen des Bundesrates infrage zu stellen. Dem Lockdown sei eine intensive Informationskampagne des Bundes vorausgegangen. Diese habe vermutlich dazu geführt, dass die Bevölkerung bereits vor den Verboten die Abstands- und Hygieneregeln befolgt habe. Zudem sehen die Forscher einen Zusammenhang zwischen der Reproduktionszahl und dem Mobilitätsverhalten der Bevölkerung. Die Zahl der Fahrten zur Arbeit, zum Einkaufen und zur Erholung sei im fraglichen Zeitraum um 50 bis 75 Prozent zurückgegangen.
2. Juni: Das Virus befällt zuerst die Nase
rtz. · Sars-CoV-2 führt bei einem Grossteil der symptomatischen Infizierten zuerst zu Krankheitsanzeichen der oberen Atemwege, im späteren Verlauf sind auch die unteren Atemwege betroffen. Doch war bisher unklar, ob das Virus als Eintrittspforte das Gewebe im Rachenraum benutzt oder eher die Schleimhäute der Nase. Amerikanischen Wissenschaftern aus North Carolina ist es mit innovativen Methoden gelungen zu zeigen, dass das Virus besonders gut die Zellen der Nasenschleimhaut infizieren kann. Sie vermuten, dass sich das Virus von dort aus den Weg in die unteren Atemwege bahnt. Die Ergebnisse wurden im Fachjournal «Cell» publiziert.
Dies fanden die Forscher heraus, indem sie zwei Ansätze miteinander kombinierten: Zunächst konstruierten sie anhand vorhandener Erbgutdaten ein künstliches, grün fluoreszierendes Sars-CoV-2-Virus. Ausserdem verwendeten sie eine hochsensible Methode zur Quantifizierung der ACE2-Rezeptormenge in menschlichen Zellen der Nasen-, Rachen- und Bronchialschleimhaut. So konnten sie feststellen, dass einerseits die Menge an ACE2 entlang des Weges von den oberen zu den unteren Atemwegen abnahm und andererseits das Virus die oberen Atemwege besser infizieren konnte.
1. Juni: Maske, Abstand und Visier – was nützt?

rtz. · Wer nach einer eindeutigen Antwort auf die Frage sucht, wie man sich im öffentlichen Raum oder bei der Arbeit am besten vor dem Erreger schützen kann, wird schnell frustriert – zu unterschiedlich sind die Einschätzungen und Empfehlungen. Jede Gesundheitsbehörde, jeder Experte scheint derzeit etwas anderes zu raten. Einen Überblick bietet eine neue Veröffentlichung im Fachmagazin «The Lancet»: Für ihre Metastudie haben die Wissenschafter 172 bis Anfang Mai erschienene Fallstudien aus 16 Ländern und 44 Vergleichsstudien ausgewertet. Insgesamt umfassen diese über 25 000 Fälle von Infektionen mit Sars-CoV-2, aber auch Mers und Sars.
Demnach ist der effektivste Schutz vor einer Infektion ein Mindestabstand von einem, besser zwei oder sogar drei Metern. Bei Gesichtsmasken und Augenschutz ist die Schutzwirkung schon nicht mehr ganz so eindeutig. Insbesondere sei das Tragen einer Maske keine Alternative zum Abstandhalten, betonen die Forscher. Auch häufiges Händewaschen und generelle Hygiene schützen. Aber selbst alle Massnahmen zusammen böten keinen vollständigen Schutz. Mitarbeiter im Gesundheits- und Pflegebereich sollten Masken mit einem möglichst hohen Schutzniveau verwenden, also jene der Schutzklasse FFP2 oder N95.
Note: This article have been indexed to our site. We do not claim legitimacy, ownership or copyright of any of the content above. To see the article at original source Click Here







